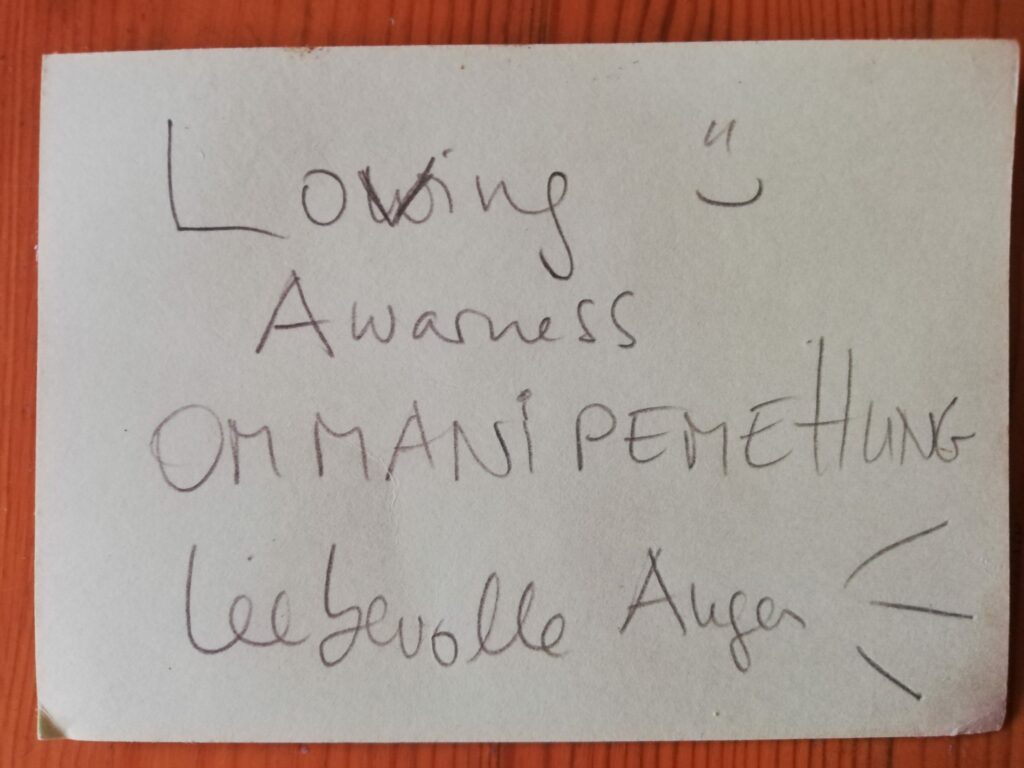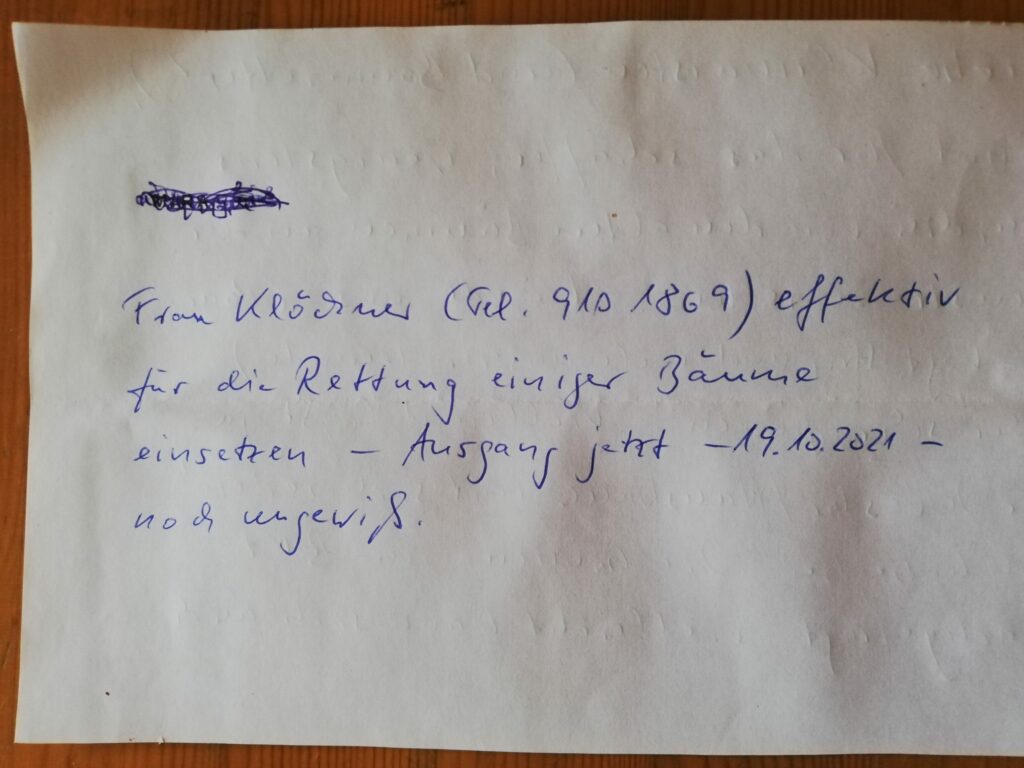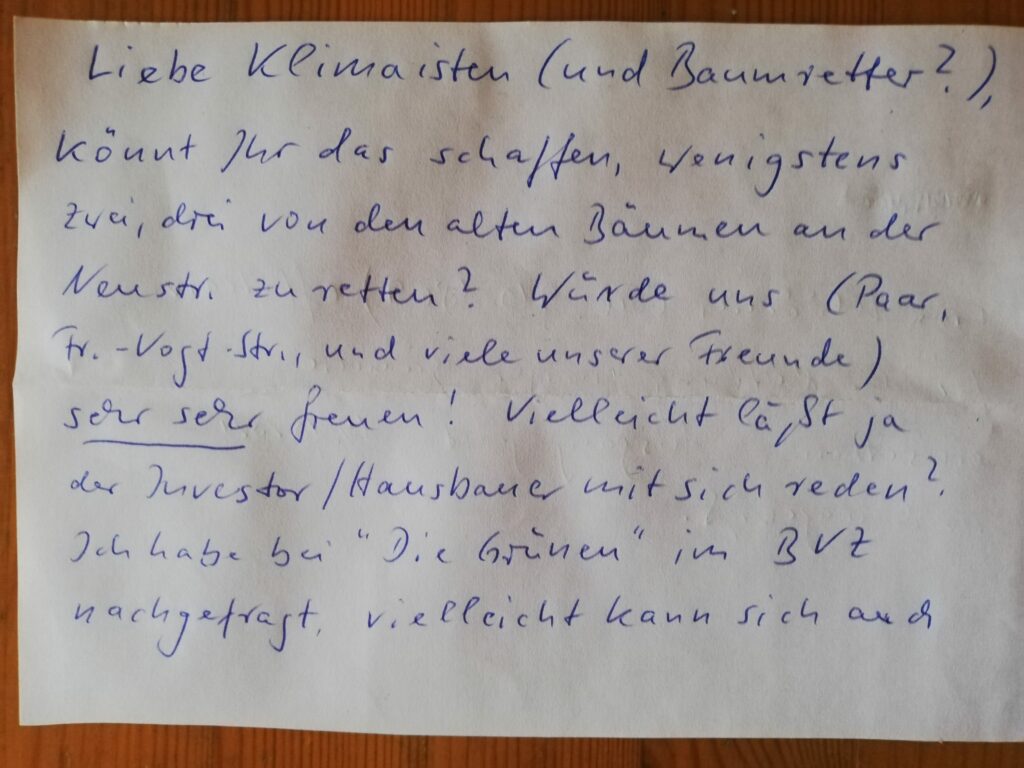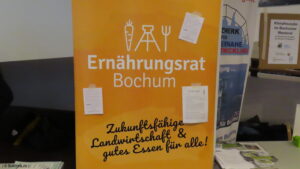Zu den Dokumenten und Links zum “Klimaplan 2035 ”
Bochum Agenda 21
Antrag an das Plenum des Forumstages am 25.03.2000
Antragsteller: AG Leitbilder (Beschluss vom 22.3.00)
Die Teilnehmenden am Forumstag fordern die zuständigen Gremien der Stadt Bochum (Agenda-Beirat und Stadtrat) auf, folgende Agenda-Projekte auf den Weg zu bringen:
I. Stadtentwicklungsplan “Nachhaltiges Bochum 2010”
Bis zum Frühjahr 2002 (Mitte der aktuellen Ratsperiode) wird vom Rat der Stadt Bochum ein Stadtentwicklungsplan “Nachhaltiges Bochum 2010” verabschiedet. Dieser Plan enthält:
- Grundsätze und Leitziele für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Bochum Eine Grundlage für den Diskussionsprozess ist das entsprechende Papier der AG Leitbilder vom 11.1.2000. Die Verabschiedung der “Grundsätze und Leitziele” durch den Rat könnte und sollte noch im Jahre 2000 erfolgen.
- Konzept für Nachhaltigkeits- und Umweltqualitätsziele mit Indikatoren
für zentraleHandlungsfelder der Stadtentwicklung
An Vorschlägen für Indikatoren nachhaltiger Entwicklung arbeitet derzeit ein Forschungsprojekt der Ruhr-Universität Bochum in Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum (Agenda-Büro). (Vgl. dazu die entsprechende Arbeitsvorlage auf dem Forumstag.)
- Handlungskonzept zur Erreichung der Nachhaltigkeits- und Umweltqualitätsziele
(Maßnahmenbündel, Zeitplan mit Zwischenschritten, Akteure, finanzieller Mitteleinsatz, Umsetzungsberichte zur Zielerreichungskontrolle) Hier kommt es darauf an, bei der Fortschreibung der verschiedenen Rahmenpläne (vgl. Bochum-Planung 2010) und Fachpläne die Nachhaltigkeits- und Umweltqualitätsziele zu konkretisieren, zu präzisieren und maßnahmenbezogen zu integrieren.
II. Klimaschutzkonzept Bochum 2010
1. Klimaschutzkonzept Bochum 2010: Als Einstieg in den Stadtentwicklungsplan “Nachhaltiges Bochum 2010” verabschiedet der Rat der Stadt bis Herbst 2001 ein Klimaschutzkonzept Bochum 2010. Das Ziel dieses integrierten Maßnahmenkonzeptes ist, die Vorgaben des Klima-Bündnisses – Reduktion der CO2-Emissionen um die Hälfte bis 2010- zu realisieren.
2. Klimaschutzbericht: Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, bis Ende des Jahres einen Klimaschutzbericht für Bochum vorzulegen. Dieser Bericht soll gleichzeitig eine Erfolgskontrolle des “Bochumer Energiekonzeptes” aus dem Jahre 1993 beinhalten.
3. Wissenschaftliches Gutachten: Um Handlungsempfehlungen für das Klimaschutzkonzept und den Klimaschutzbericht auf fundierter Datenbasis zu erarbeiten, gibt der Rat der Stadt noch im Frühjahr 2000 ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag. Dessen Aufgaben sind:
- Umsetzungsorientierte Maßnahmenvorschläge, insb. für die klimarelevanten Bereiche Energie
- Als Grundlage für die Maßnahmenvorschläge: Erhebung der Ist-Situation beim Energie-
Die Erfahrungen mit entsprechenden Gutachten für andere Städte zeigen, dass für ein fundiertes Klimaschutz-Gutachten ein Kostenansatz von 150.-200.000 DM erforderlich ist. Für dieses Gutachten soll daher für den kommenden Jahresetat 2000 der Stadt ein Betrag in Höhe von 150.-200.000 DM bereitgestellt werden (unabhängig vom Agenda-Budget).
Die Beantragung dieses Haushaltspostens ist dringlich, da die Verabschiedung des Haushaltes auf der Hauptausschusssitzung am 3.5.2000 ansteht.
Begründung des Antrags:
Der Bochumer Agenda-Prozess befindet sich nun seit über einem Jahr in seiner aktiven Phase (Beginn mit der Info-Börse am 30.1.99). Es ist daher an der Zeit, dass sich die Agenda-Aktiven über ihre Beteiligung an Arbeitsgruppen, Foren und der Vorbereitung von Einzelprojekten hinaus darüber verständigen, zu welchem konkreten Ziel mit welchen Zwischenschritten in welchem Zeitrahmen die Agenda-Aktivitäten insgesamt hinführen sollen.
Der Agenda-Prozess: Initiierung einer nachhaltigen Entwicklung für die gesamte Stadt oder Förderung von Einzelprojekten?
Auf dem Foren-Tag soll die Vorstellung von Projekten aus der Arbeit der einzelnen Foren einen gewichtigen Raum einnehmen, um eine Entscheidung über die Förderung von ausgewählten Projekten aus dem Budget des Agenda-Prozesses vorzubereiten.
Nichts spricht gegen das Vorgehen, einzelne Projekte finanziell zu fördern, die in besonderer Weise geeignet erscheinen, eine nachhaltige Entwicklung in Bochum anzustoßen und diesen Entwicklungsprozess gleichzeitig zum Ausdruck zu bringen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind allerdings Zweifel angebracht, den noch jungen Agenda-Prozess auf die Auswahl von Einzelprojekten zu fokussieren, da noch keinerlei Verständigung unter den Agenda-Beteiligten über das Gesamtprofil der angestrebten nachhaltigen Entwicklung in Bochum erfolgt ist. Bevor hierüber aber keine tragfähige Klärung erreicht ist, besteht die Gefahr, dass die Konzentration auf Einzelprojekte von der Befassung mit der Gesamtentwicklung der Stadt ablenkt und darüberhinaus inhaltlich gesicherte Entscheidungsgrundlagen für die Auswahl von Einzelprojekten fehlen. Über Einzelprojektförderung hinaus wird aber der Agenda-Prozess seinem Anspruch auf Nachhaltigkeit nur gerecht, wenn er in einem integrativen Politikansatz die Gesamtentwicklung der Stadt Bochum in den Blick nimmt.
Integrativer Agenda-Ansatz
Bei einem integrativen Ansatz des Agenda-Prozesses stehen nicht Einzelaspekte, sondern die Stadtentwicklung in ihrer Gesamtheit und Vielfalt auf dem Prüfstand. Auf dem Weg über die Formulierung von konkreten Qualitätszielen soll der Agenda-Prozess in ein konkretes und verbindliches Handlungs- und Maßnahmenprogramm der Stadt führen. Zu vermeiden ist, dass die Agenda 21 ein unverbindlicher Empfehlungskatalog für die Entscheidungsträger der Stadt wird. Vielmehr sollte die Bochum Agenda 21 das zentrale Steuerungsinstrument für die zukünftige Stadtentwicklung werden. Dabei müssen die verschiedenen Handlungsfelder der kommunalen Politik unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Entwicklung miteinander vernetzt werden.
Der Agenda-Prozess als Initiierung einer grundlegenden Neuausrichtung der städtischen Entwicklung auf das Ziel der Nachhaltigkeit schließt die Förderung von Einzelprojekten (Projektansatz) gerade dann ein, wenn diese Vorbild- und Initialfunktion für die weitere städtische Entwicklung haben.
Verfahrensschritte
Unverzichtbar ist es, sich auf einen tragfähigen Konsens über die Grundsätze und Leitziele für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Bochum zu verständigen. Bezogen auf die zentralen Handlungsfelder der städtischen Politik müssen dann konkrete Umweltqualitätsziele
(z.B. zur Reduzierung der Luftverschmutzung) formuliert werden, deren Umsetzung anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren (z.B. CO2-Emission) dann gemessen und kontrolliert werden kann. Bezogen auf die zentralen Handlungsfelder muss dann eine Ist-Analyse (Bestandsaufnahme) erfolgen, um anschließend aus der Differenz von Ist- und Soll-Zustand die Maßnahmen ableiten zu können, die zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung erforderlich sind. Die Umweltqualitätsziele dienen also als politisch relevante Entscheidungs- und Handlungsgrundlage für die politischen Entscheidungsträger.
Um den mittlerweile ein Jahr alten Agenda-Prozess in einem überschaubaren Zeitrahmen zum Erfolg zu führen, erscheint es notwendig und zielführend, für die einzelnen Verfahrensschritte (bei aller gebotenen Vorsicht ) zeitliche Vorgaben zu vereinbaren. Ansonsten droht der Prozess, sich ins Unverbindliche zu verlaufen.
Aus dem ganzheitlichen Ansatz des Agenda-Prozesses folgt, dass es nicht damit getan ist, ein Agenda-Budget mit 200.000 DM/Jahr auszustatten bei einem Haushaltsvolumen der Stadt Bochum von ca. 1,7 Milliarden DM. Vielmehr ist es erforderlich, das gesamte Ausgabeverhalten der Stadt an den Kriterien der Nachhaltigkeit auszurichten.
Es ist schwierig, mit der nachhaltigen Entwicklung konkret zu beginnen, wenn man nicht zu Beginn eine sinnvolle Auswahl von Maßnahmen trifft. Für eine solche Auswahl bietet sich ein Handlungsfeld an, das selbst schon hinreichend komplex (fachpolitik-übergreifend) und in hohem Maße konsensual ist. Dies trifft in einzigartiger Weise für das Feld des Klimaschutzes zu.
Klimaschutzkonzept als Einstieg in eine ganzheitliche nachhaltige Entwicklung
Der Klimaschutz stellt sowohl eine globale wie auch nationale und kommunale Aufgabe allerersten Ranges dar, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Aus diesem Grunde ist auch die Stadt Bochum seit 1994 Mitglied im “Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder”. Die Mitglieder dieses Bündnisses verpflichten sich auf eine “Reduzierung der CO2-Emissionen der Kommunen mit dem Ziel einer Halbierung bis zum Jahr 2010″ sowie auf eine “weitgehende Reduzierung aller treibhausrelevanten Gase im kommunalen Bereich” (Zweck des Vereins, §2 der Vereinssatzung). Bisher fehlt in Bochum die Ausarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes, das umfassend Maßnahmen enthält, die die Erreichung dieses ehrgeizigen Klimaschutzzieles gewährleisten können.
Wir schlagen vor, die Erarbeitung eines Bochumer Klimaschutzkonzeptes mit zeitlichem Vorrang anzugehen. Ein solches Handlungskonzept umfasst die Bereiche Energie, Verkehr, Stadtplanung, Umwelt, Soziales als auch Wirtschaft(sförderung). Es ist also aufgrund seiner Komplexität wesentlich mehr als ein Einzelprojekt. Um gesicherte Zielvorgaben für die Politik machen zu können, ist zuerst eine Bestandsaufnahme der CO2-Emissionen –nach Verursacherbereichen getrennt- im Bereich der Stadt Bochum erforderlich. Diese Arbeitsschritt sollten –wie in anderen Agenda-Kommunen auch- von einem ausgewiesenen wissenschaftlichen Institut ausgeführt werden.