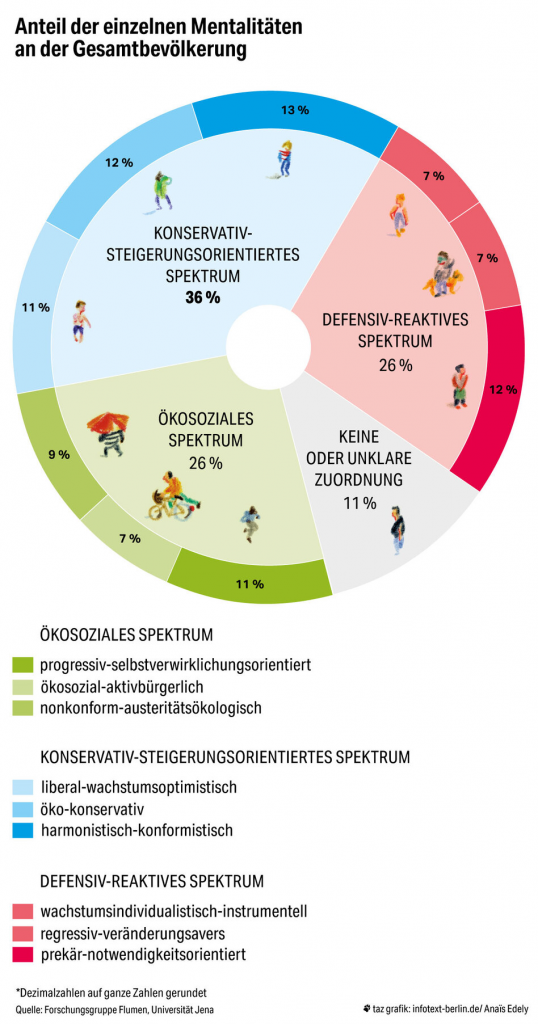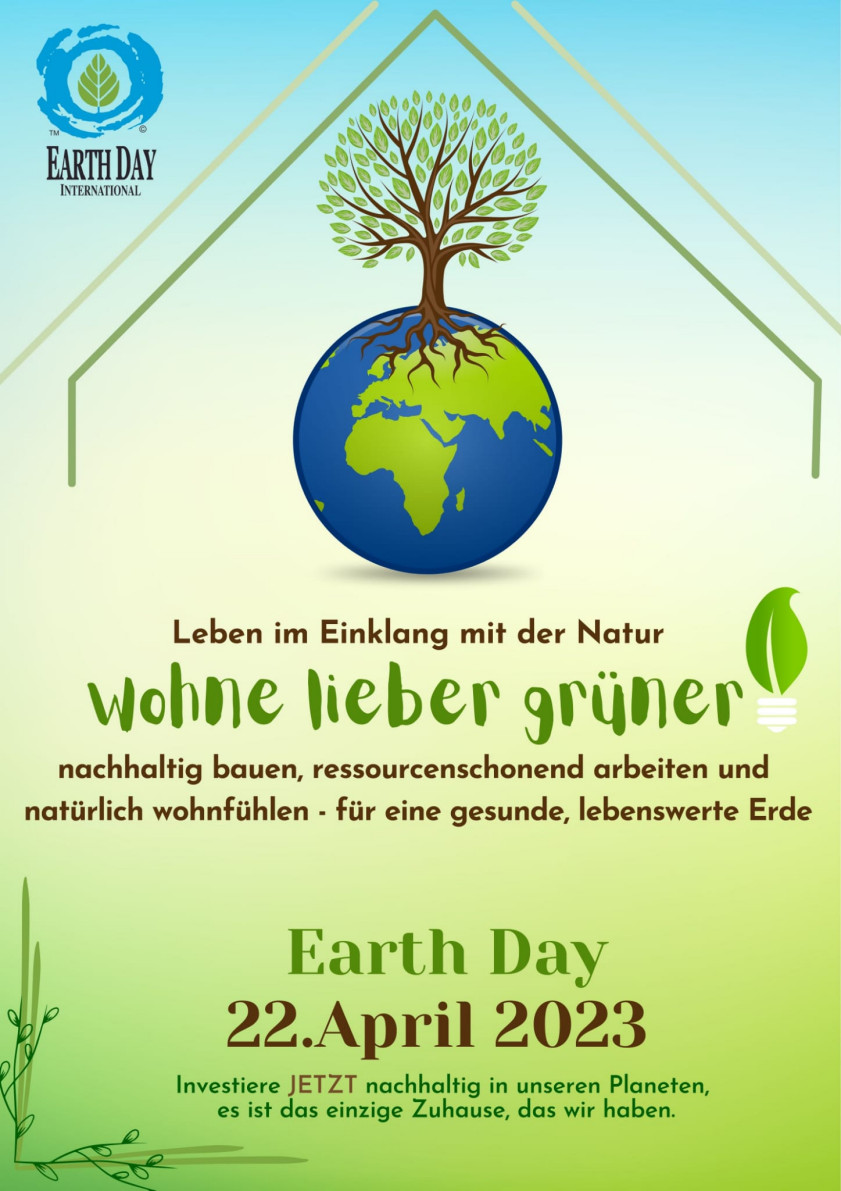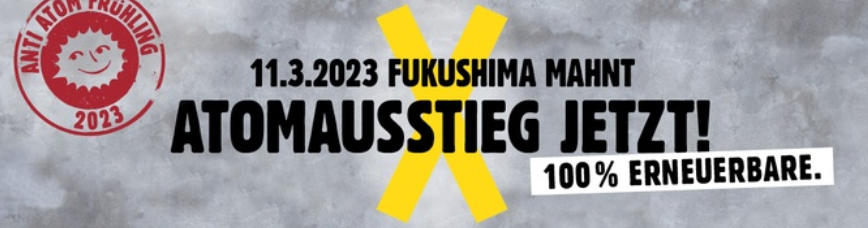(15.05.23 , bund) , Original: hier
Diese Flasche ist im deutschen Sortiment des Discounters Lidl zu finden. Es handelt sich dabei um eine 1,5 l PET-Einwegflasche, deren Flaschenkörper laut Hersteller zu 100 Prozent aus recyceltem PET-Kunststoff besteht. Durch den Einsatz von Recyclingmaterial für die Produktion, das geringere Gewicht und die höhere Kompression beim Leerguttransport soll die Ökobilanz der Flaschen besser sein als jene von Glas- & PET- Mehrwegflaschen. Dazu wurde extra eine Studie beim Institut für Energie und Umwelt (IFEU) in Auftrag gegeben.
Lobbying statt Lösung
Der Zeitpunkt ist klug gewählt. Nationale und europäische Gesetze sollen demnächst mehr Mehrweg vorschreiben. Lidls Kampagne täuscht die Möglichkeit eines verlustfreien Recycling-Kreislaufs vor und will die Öffentlichkeit glauben lassen, dass wir uns aus der Plastikkrise raus-recyceln können. Wirklich nachhaltige Alternativen wie unverpackt-Lösungen (z.B. gesundes Leitungswasser statt Flaschenwasser) und ein flächendeckender Ausbau der Mehrweginfrastruktur durch eine verbindliche und überfällige Mehrweg-Gesetzgebung sind akut durch die finanzstarke Kampagne gefährdet.
Wieso täuscht die Bilanz?
Es gibt rein physikalisch und auch prozessbedingt keine verlustfreien Stoffkreisläufe. Nicht jede Flasche landet wieder im Kreislauf. Lidl sammelt derzeit mehr ein, als sie produzieren. Nur so können die unvermeidlichen Materialverluste ausgeglichen werden. Dieser wird bei anderen Herstellern mit neuen Flaschen mit großen Anteilen an Neuplastik ausgeglichen. Es gibt also keine PET-Flasche, die vollständig recycelt werden kann, ohne zusätzliches neues Plastik einzubringen.
Gesundheit ist gefährdet durch PET
Für die PET-Produktion werden viele verschiedene Chemikalien eingesetzt. Lidl spricht in den Kreislaufflaschen-FAQs verdächtige Stoffe wie Bisphenol (möglicher Eingriff in das Hormonsystem) oder Acetaldehyd (verdachtsweise krebserregend) an. Die Palette an eingesetzten Chemikalien ist jedoch breiter. Dabei handelt es sich um Stoffe wie 2-Methyl-1,3-dioxolan oder Nonanal, die direkt vom PET-Material auf den Flascheninhalt übergehen können. Wir wissen auch, dass PET-Nanoplastik mittlerweile ins Gehirn gelangt.
Mehrwegsysteme optimieren und ausbauen
Der BUND fordert den Ausbau poolfähiger Mehrwegsysteme und Mehrweg zum neuen Normal zu machen, die für alle Firmen zugänglich sind. Insellösungen von großen Handelsketten dienen nur der Stärkung der eigenen Marktmacht. Dafür brauchen wir eine starke Gesetzesgebung und Sanktionen für die, die sich nicht dranhalten.
Sie möchten mehr über Mehrweg lesen? Unser BUND-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden. Jetzt hier abonnieren.
Mehr Infos
- über Plastik und Schadstoffe in Plastik
Weitere Links :
- (, deutsche Umwelthilfe ) , Mehrweg ist Klimaschutz
- (16.05.23, deutsche Umwelthilfe) , Lidl-Kampagne zu Einweg-Plastikflaschen: Deutsche Umwelthilfe geht rechtlich gegen den Vorwurf von Falschbehauptungen gegen den Discounter vor
- (16.05.23, finanznachrichten) , Lidl-Kampagne zu Einweg-Plastikflaschen: Deutsche Umwelthilfe geht rechtlich gegen den Vorwurf von Falschbehauptungen gegen den Discounter vor
- (24.04.23, br) , Sind Glasflaschen besser als Plastikflaschen Einweg oder Mehrweg? Welche Flaschen sind umweltfreundlicher?
Wasser ist das beliebteste Getränk der Deutschen. Einweg- oder Mehrwegflasche, Kunststoff oder Glas. Welche Flasche ist am umweltfreundlichsten? - (01.02.23, ard-alpha) , Mehrwegflasche oder Einwegflasche – welche ist umweltfreundlicher?