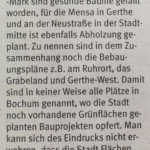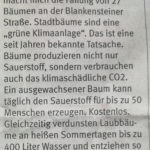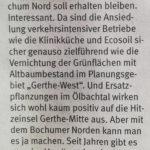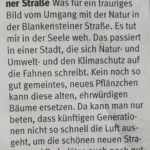Kategorie: Aktuell
Petition 116046 Klimaschutz
Einberufung von einem bundesweiten Bürgerrat zur Klimapolitik
Text der Petition
Der Bundestag möge beschließen, einen bundesweiten Bürger*innenrat zur Klimapolitik einzuberufen. Dieser soll repräsentativ und unabhängig sein und über folgende Frage beraten: Welche Maßnahmen soll Deutschland bis 2035 unter Berücksichtigung der sozialen Gerechtigkeit ergreifen, um seinen Beitrag zur Einhaltung der Pariser Klimaziele zu leisten? Der Bundestag möge sich verpflichten, die Vorschläge des Bürger*innenrats in seiner Gesetzgebung zu berücksichtigen.
Begründung
Ein Bürger*innenrat bringt Menschen mit ganz verschiedenen Lebenserfahrungen und Sichtweisen zusammen, gibt ihnen die Möglichkeit sich umfassend zu informieren und gemeinsam Lösungsvorschläge für die Politik zu erarbeiten. Bürger*innenräte können unsere Demokratie stärken und zugleich eine faktenbasierte und faire Klimapolitik auf den Weg bringen, die von der Breite der Bevölkerung mitgetragen wird.
…
Zum unterzeichnen :
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2020/_09/_16/Petition_116046.nc.html
Aufruf wird auch unterstützt von Sven Gigold , Grüner Abgeordneter im EU-Parlament :
Petition für einen Klima-Bürger*innenrat jetzt unterzeichnen!
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte,
Bürger*innenräte sind eine spannende Möglichkeit, unsere Demokratie zu stärken und gleichzeitig das Jahrhundertthema Klimakrise anzugehen. Bürger*innenräte verbinden direkte Demokratie mit gründlicher und überlegter Debatte. Im neuen Grundsatzprogramm haben wir Grünen uns grundsätzlich für Bürger*innenräte auf Bundesebene ausgesprochen. Nun setzt sich die Initiative Klima-Mitbestimmung JETZT für einen solchen Klima-Bürger*innenrat mit einer Petition an den Deutschen Bundestag ein. Ihre Petition hat bereits mehr als 47.000 Unterschriften, aber um im Bundestag Beachtung zu finden brauchen sie bis zum 17. Dezember mindestens 50.000 Mitzeichner*innen! Für diesen Schlussspurt ist jede Unterstützung willkommen: jetzt unterschreiben und diese E-Mail gerne weiterleiten!
In Frankreich, Irland und Großbritannien konnten Klima-Bürger*innenräte bereits wichtige Impulse setzen, die wir auch in Deutschland dringend brauchen. Ich wünsche Klima-Mitbestimmung JETZT möglichst viele Unterstützer*innen, damit ihr Anliegen in der Politik Gehör findet. Zudem freue ich mich, dass mit Mira Pütz eine der Gründer*innen in meinem Brüsseler Team arbeitet (so viel Transparenz muss sein!).
Was ist das Besondere an einem Bürger*innenrat?
Ein bundesweiter Bürger*innenrat ist wie ein Miniatur-Deutschland: 150 Bürger*innen werden per Zufallslos so ausgewählt, dass sie die Vielfalt in der Bevölkerung repräsentieren. Fast wie bei einer repräsentativen Stichprobe für eine Umfrage, nur dass die Mitsprachemöglichkeiten bei einem Bürger*innenrat viel weitreichender sind als in einer einseitigen Befragung. Denn die Teilnehmenden treffen sich über mehrere Wochenenden hinweg, hören Vorträge von unabhängigen Wissenschaftler*innen und erarbeiten gemeinsam Handlungsempfehlungen für die Politik. Die gemeinsamen Gespräche finden in wechselnden Kleingruppen statt und werden moderiert, sodass ein respektvoller Austausch auf Augenhöhe ermöglicht wird. Diese Prozessgestaltung geht auf die diskurstheoretische Arbeit von Jürgen Habermas zu folgender Frage zurück: wie müsste ein Entscheidungsprozess gestaltet sein, sodass am Ende das beste Argument gewinnt?
Bei einem Bürger*innenrat kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenserfahrungen ins Gespräch, die sich sonst nie begegnet wären. Außerdem konnten Wissenschaftler*innen aus Irland nachweisen, dass das gemeinsame Abwägen von Argumenten den Blick für das Gemeinwohl stärkt. Die Teilnehmenden eines Bürger*innenrats haben kein Amt zu verlieren und repräsentieren keine spezifische Bevölkerungsgruppe – das ändert die Dynamik und ermöglicht es Bürger*innenräten, kontroverse Fragen mit Blick auf die Zukunft anzugehen.
2004 wurde ein solcher Bürger*innenrat erstmals in Kanada einberufen, um einen Vorschlag für eine Wahlrechtsreform zu entwickeln. Die Teilnehmenden standen nicht selbst zur Wahl, sie hatten kein Interesse daran, ihre eigene Wiederwahl oder eine bestimmte Anzahl an Mandaten zu sichern. Stellvertretend für alle Menschen in ihrem Bundesstaat hatten sie eingewilligt, eine möglichst faire Reform zu erarbeiten. Was fair in diesem Zusammenhang bedeuten sollte haben sie gemeinsam, in Rücksprache mit Expert*innen, erörtert. Internationales Aufsehen erregte auch ein Bürger*innenrat in Irland, der eine ausgewogene, respektvolle Debatte zur Reform des Abtreibungsrechts ermöglichte. Bürger*innenräte geben den Teilnehmenden die Möglichkeit, informiert und eigenständig zu entscheiden, Prioritäten hochzuhalten und Akzente zu setzen.
Auch zur Klimakrise hat es bereits mehrere Bürger*innenräte gegeben, die Handlungsempfehlungen für eine ambitionierte und sozial gerechte Klimapolitik erarbeiten sollten. Die Ergebnisse der Bürger*innenräte in Irland (2017), Frankreich (2019-20) und Großbritannien (2020) zeigen eindeutig, dass eine informierte Stichprobe der Bevölkerung die Notwendigkeit von tiefgreifenden Veränderungen anerkennt und diese einfordert. Dadurch kann ein Klima-Bürger*innenrat ein starkes Signal an die Politik senden und die öffentliche Debatte bereichern, indem verschiedene Handlungsoptionen sichtbar gemacht werden. Während sich in anderen Formen der Bürger*innenbeteiligung oftmals nur bestimmte Bevölkerungsgruppen einbringen – z.B. jene, die sich das Engagement zeitlich und finanziell leisten können oder zutrauen – spiegelt ein Bürger*innenrat durch die Zufallsauswahl die Vielfalt unserer Gesellschaft wider.
Damit ein Bürger*innenrat nicht nur ein Zeichen setzt sondern nachhaltig Veränderungen anstößt, ist die Einbettung in unseren politischen Prozess unerlässlich. Es braucht ein politisches Mandat von der Regierung, mit einer konkreten Fragestellung und Zusagen für „Danach“. So hatte Emmanuel Macron den Teilnehmenden des französischen Klima-Bürger*innenrats zugesagt, ihre Empfehlungen „ohne Filter“ umzusetzen. Das fordern die 150 Teilnehmenden nach der Bekanntgabe der Handlungsempfehlungen nun ein und sie werden auch während des Umsetzungsprozesses immer wieder konsultiert. Und deshalb ist eine erfolgreiche Petition an den Deutschen Bundestag hier so wichtig.
Wir Grünen fordern in unserem Grundsatzprogramm die Einberufung von Bürger*innenräten um die Gesellschaft stärker in große Entscheidungen einzubinden. Ein Bürger*innenrat zur Klimapolitik in Deutschland wäre doch ein toller Anfang!
Mit demokratischen europäischen Grüßen
Sven Giegold
Rettung Bäume Neustr. ( 8.KNB) ; Aktionsverlauf ; WAZ Bericht 2015!
8.KNB – ( 16.12.20 ) Nibelungentreue der Wirtschaftsförderung statt nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz?
(siehe hier weiter unten)
Aktionsverlauf ; (Presse-) Berichte
( 28.02.21 ) neue Plakate ; Flugblatt wird an die Anwohner verteilt
Die neuen Plakate gibt’s hier
( 20.02.21 ) Leserbriefe
( 19.02.21 ) Ausschuss für Planung und Grundstücke – 02.03.2021 – 15:00 Uhr
- Link ins RIS : hier
- Link zur TO (als pdf) : hier
- hier sind wir als to-Punkt 1.2 dran :
- 1.2 Beschwerde mit Anregung nach § 24 Gemeindeordnung NRW (GO) im Rahmen eines offenen Briefes des Bochumer Klimaschutzbündnisses (BoKlima) zur Entwicklung des städtischen Grundstücks an der Kreuz- und Neustraße
- Vorlage: 20210135
- Link zur Beschlussvorlage — unser Antrag soll abgelehnt werden , hier :
- Kurzübersicht:
- Das Bochumer Klimaschutzbündnis hat mit einem auf den 16.12.2020 datierten offenen Brief zur Entwicklung des ehem. Firmengeländes von Gustav Schwager Nachf. auf die Einhaltung des Klimanotstandsbeschlusses hingewiesen. Anlass ist die Berichterstattung der WAZ Bochum vom 12.12.2020 über das geplante Bauvorhaben eines Investors auf der städtischen Fläche an der Kreuzstraße und Neustraße.
- Beschlussvorschlag:
- Über die Beschwerde mit Anregung nach § 24 GO NRW wird wie folgt entschieden:
- zu Punkt 1 – Sofortiger Stopp der Abbrucharbeiten
- Die Abbrucharbeiten werden ohne Verzögerung weitergeführt.
- zu Punkt 2 – Erhalt der zwölf alten Laubbäume
- Zunächst gelten die bestehenden Beschlüsse. Eventuell notwendige Baumfällungen sind auszugleichen.
- Link zum 8. KNB im RIS : hier
( 11.02.21 ) – WAZ – Leserbrief
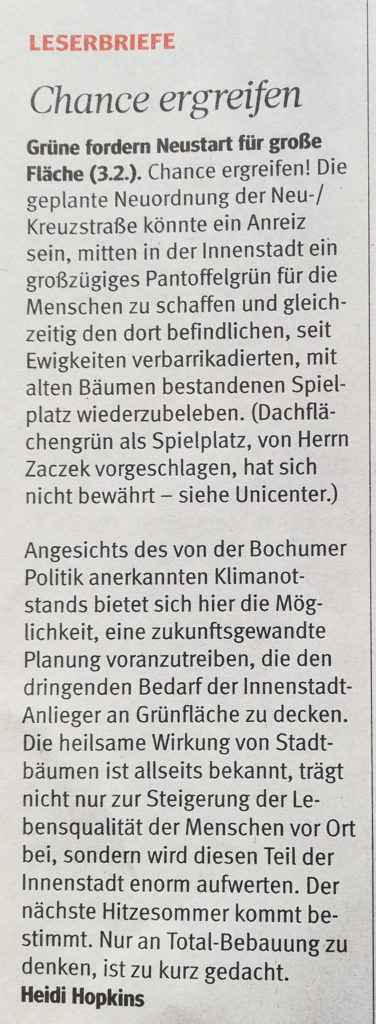
03.02.21 – WAZ – Grüne fordern einen Neustart für große Fläche in Bochum
Grüne 02.02.2021, Bochum. Für die Fläche zwischen Kreuz- und Neustraße in Bochum soll es einen Neustart geben. Die Grünen fordern, dass das stimmigste Konzept gewinnt.
Für die ungenutzte – 5200 Quadratmetern große – Fläche zwischen Kreuzstraße und Neustraße im Herzen des Bermudadreiecks in Bochum soll es einen Neustart geben. Das fordern die Grünen im Rat der Stadt Bochum. Die Versuche der vergangenen Jahre betrachten sie als gescheitert. Stadtenwicklung Noch ein Konzept für begehrtes Innenstadt-Areal in Bochum
Die Fraktionsvorsitzende Barbara Jessel erklärt dazu: „Sollte eine Abstimmung mit den Interessenten aus dem Kreativbereich auf Grundlage des vorliegenden Entwurfes in Kürze nicht zustande kommen, muss ein Bestgebotsverfahren eingeleitet werden; mit einer zielführenden Ausschreibung …
Fläche zwischen Kreuzstraße und Neustraße: Zuschlag für stimmigstes Konzept
Vicki Marschall, Ratsmitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG), sieht in einem Bestgebotsverfahren, bei dem nicht das höchste abgegebene Gebot sondern das stimmigste Konzept den Zuschlag erhält, einen erfolgversprechenden Weg: „Wir sollten Kreativen nicht nur flächenmäßig Raum geben, sondern auch gedanklich. Neue Ansätze zuzulassen, fördert Wirtschaft und Gesellschaft gleic hermaßen.“
(31.01.21) Aktuelle Ansichten Neustr bei Sonne ….



30.01.21 – WAZ

(29.01.21) PM: Grüne wollen Neustart für Areal an der Kreuzstraße / Neustraße
Die Grünen im Rat wollen einen Neustart zur Entwicklung des ungenutzten Areals im Bereich Kreuzstraße und Neustraße im Herzen des Bermudadreiecks. Die Versuche der vergangenen Jahre betrachten sie als gescheitert.
Die Fraktionsvorsitzende Barbara Jessel erklärt dazu: „Sollte eine Abstimmung mit den Interessenten aus dem Kreativbereich auf Grundlage des vorliegenden Entwurfes in Kürze nicht zustande kommen, muss ein Bestgebotsverfahren eingeleitet werden; mit einer zielführenden Ausschreibung für ein lebendiges Quartier in dem kreativen Firmen auch aus dem IT-Bereich, Start-Ups und Wohnen, aber auch jungen Menschen Platz für Entfaltung gegeben wird.“
Vicki Marschall, Ratsmitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG), sieht in einem Bestgebotsverfahren, bei dem nicht das höchste abgegebene Gebot sondern das stimmigste Konzept den Zuschlag erhält, einen erfolgversprechenden Weg für ein transparentes Verfahren. Marschall: „Wir sollten Kreativen nicht nur flächenmäßig Raum geben, sondern auch gedanklich. Neue Ansätze zuzulassen, fördert Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen.“
Dr. Frank Taschner , Fraktionsgeschäftsführer , Die Grünen im Rat
BVZ – Zimmer 2035 , Gustav-Heinemann-Platz 2-6 , 44777 Bochum

8.KNB (16.12.20) : Nibelungentreue der Wirtschaftsförderung statt nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz?
Weiere Interne Diskussionen im internen Bereich : hier
WAZ – Artikel von 2015 s. unten
Impressionen der Plakat-Aktion
Plakat – Aktion :
12.12.20 , WAZ zu Neustr :
18.09.2015 (!!) , WAZ zu Neustr , 2015 , Kanzlei plant Bauinvestition

Artikel WAZ 18.09.2015 zu NeuStr :
https://www.waz.de/staedte/bochum/nord/kanzlei-plant-grosse-bauinvestition-id11103017.html
Stadtentwicklung Kanzlei plant große Bauinvestition , Andreas Rorowski
18.09.2015, 10:00
Der Spielplatz an der Neustraße soll einem Ärztehaus weichen. Ein Ausgleich soll an anderer Stelle in Mitte entstehen.
Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Serv
Bochum-Mitte. Im Dreieck Kreuz-/Neu-/Brüderstraße sollen ein Bürogebäude und ein Ärztehaus entstehen. Der Spielplatz an der Neustraße soll weichen.
Es hat schon mehrere Versuche gegeben, die schier unübersichtliche Situation des abbruchreifen Gebäudeensembles auf einem städtischen Grundstück im Dreieck Kreuzstraße/Neustraße/Brüderstraße zu verändern und dort neu zu bauen. Nun liegt erneut ein vielversprechender Vorschlag auf dem Tisch. Unweit des Bermuda-Dreiecks will eine Bochumer Kanzlei insgesamt drei Gebäude mit weit mehr als 3000 Quadratmeter Gesamtfläche errichten.
Grünfläche im Blockinnenraum
Dazu soll an der Kreuzstraße in einer Baulücke ein mehrgeschossiges Bürogebäude mit 1000 Quadratmeter Gesamtfläche entstehen. Dahinter ist eine langgezogene, zweigeschossige Gebäudespanne mit überwiegend barrierefreiem Wohnraum geplant. 3680 Quadratmeter groß ist das gesamte, nahezu rundum von bebauten Grundstücken umsäumte Areal in bester Lage unweit von Bahnhof, Innenstadt und Bermuda-Dreieck. Die derzeit noch auf dem Grundstück stehenden ehemaligen Lager- und Büroräume sollen abgerissen werden und so auch Platz für eine Grünfläche in dem Blockinnenraum entstehen.
Aus Sicht von Verwaltung und Wirtschaftsförderung ist das Projekt indes erst dann rund, wenn auch ein hinter dem betreffenden Areal gelegener, 1470 Quadratmeter großer Spielplatz an der Neustraße in die Planungen mit einbezogen wird. Von einem „städtebaulichen Impuls“ war im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie die Rede. Vertretbar ist diese Veränderung aus Sicht der Verwaltung deshalb, weil der betreffende Spielplatz nahezu ungenutzt ist.
Spielplatz nur wenig besucht
Tatsächlich wird er nach WAZ-Erkenntnissen auch zu unterschiedlichen Tageszeiten nur selten von Kindern und eher gelegentlich von Jugendlichen besucht. In Absprache mit dem Investor könnte dort stattdessen ein Ärztehaus mit einer Gesamtfläche von 2000 Quadratmetern entstehen.
„Im Prinzip geht das“, lautete der Tenor im Ausschuss. Allerdings legten SPD und Grüne in einem Änderungsantrag Wert darauf, dass festgelegt wird, dass die entfallene Spielfläche und der dortige Treffpunkt für Jugendliche ersetzt werden müssen. Und: „Die Ersatzfläche kann an anderer Stelle ausgewiesen werden und ist durch den Investor zu finanzieren.“ Das sollte sich als mehrheitsfähiger Vorschlag erweisen. Die Ersatzmaßnahmen sollen aus dem Kaufpreis finanziert werden. Möglich sei, am in der Nähe gelegenen Riff einen Treffpunkt für Jugendliche zu errichten. Nach der Vorstellung der Verwaltung könnte der Verlust des Spielplatzes durch eine Erweiterung des hinter dem Rathaus gelegenen Spielplatzes im Appolonia-Pfaus-Park kompensiert werden.
Kommentare (2) Leserkommentare (2)
- Baumliebhaber23.09.2015 18:08 Kanzlei plant große Bauinvestition So wird das letzte städtische Grün zubetoniert., Jede noch so kleinste Lücke wollen sogenannte Investoren zubetonieren. Irgendwas reinstopfen. Und die Stadt macht munter mit und sagt zu allen Ja und Amen und wer weiss was für Briefumschläge mit Füllung doch den Besitzer wechselt und wenn nur das Haus eines Verantwortlichen neu verputzt oder das Bad neu gemacht wird. Irgendwas fällt denen schon ein.
Und deswegen ist Bochum auch leider so schäbig geworden und Austauschbarer Architektur. Kennste einen Bau kennste alle.
Weniger anzeigen Antworten Melden - FM85018.09.2015 14:20 Kanzlei plant große Bauinvestition Gibts eigentlich nicht ausreichend leerstehende Gewerbeimmobilien, das der letzte Grashalm in der Innenstadt ausgerissen werden muss ? Investor,…. tse !
Hallo an alle Bäume rettenden Klimaschützer,
wir vom Bochumer Klimaschutzbündnis wollen morgen (Di., 15.12.20) mit einer spontanen Aktion versuchen die Bäume auf dem ehemaligen Spielplatz an der Neustraße in der Innenstadt (s Anhänge via Link bzw. unten eingebunden :
http://media.boklima.de/nextc/index.php/s/ryeGQ3yrYXPTTWm
)
zu retten. Es sind 12 Bäume, welche für die Kühlung der Umgebung wichtig sind um die Hitzeinsel wenigstens etwas abzumildern.
Stefan und ich werden morgen 12 laminierte Plakate fertigstellen und suchen Leute die helfen diese pressewirksam ab mittags aufzuhängen.
?? Wer will mit welchem Zeitfenster bei der Aktion helfen?
!! Bitte dringend bei Ingo melden (bitte mit Handynummer) !!
Ich melde mich dann per Handy kurzfristig zur koordinierung.
Wer könnte professionelle Fotos anfertigen?
Viele Grüße
Ingo & Boklima …
Weitere Infos zu Aktionen etc im Internen Bereich (nach Anmeldung) :
a) im Forum : hier
b) im internen Beitrag : hier
Anhänge:
Erhalt der Frei- und Ackerfläche (Offener Brief , BI Hinter der Kiste )
Offener Brief
Wohnungsbedarf in Bochum
Erhalt der Frei- und Ackerfläche „6.04 Hattinger Straße / Hinter der Kiste“ in Bochum-Linden
WAZ Bochum : Klimaschutzbündnis wirft der Stadt “Versagen” vor
(WAZ , 13.12.20 , Original : hier )
Umwelt 13.12.2020, 15:21

Bochum. Das „Bochumer Klimaschutzbündnis“ wirft der Stadt „weitestgehend Versagen“ beim Klimaschutz vor. Es gehe nur „im Schneckentempo“ voran.
Mit scharfen Worten kritisiert das „Bochumer Klimaschutzbündnis“ die aktive Klimapolitik der Stadt Bochum. Zum 5. Jahrestag des Pariser Klimaschutzabkommens schrieb das Bündnis „BoKlima“ einen offenen Brief an Politik, Verwaltung, Wirtschaft „und an uns, Bochums Bürger“. In dem Abkommen haben fast 190 Staaten der Welt unter anderem beschlossen, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen.
Klimabündnis: In Bochum gehe der Klimaschutz nur „im Schneckentempo“ voran
In Bochum gehe es „allenfalls im Schneckentempo voran“, heißt es in dem Brief. Der Stadtrat habe vor 18 Monaten zwar den „Klimanotstand“ ausgerufen, jedoch würden bis heute „die permanent zu treffenden Entscheidungen nur sehr unzureichend auf Ihre klimatischen Auswirkungen geprüft“. Die Überprüfung des Wohnbaulandkonzepts würde vor sich hergeschoben. Die Ostpark-Bebauung in Altenbochum und Havkenscheid werde als europaweites Klimaschutzvorzeigeprojekt beworben, bleibe aber weit hinter schon lange vorhandenen Möglichkeiten zu Energiegewinnsiedlungen zurück.
Weiter beklagt „BoKlima“: „An Gebäuden, die heute errichtet werden und deren CO2-Fußabdruck weit in die Zukunft fest geschrieben wird, müsste alles Menschenmögliche umgesetzt werden, anstatt nur wenige Schritte in die richtige Richtung zu gehen.“ An der Neustraße in der Innenstadt sollen für die Baumaßnahmen eines Investors ein weiteres Dutzend alter Bäume fallen. Ausgleichspflanzungen in der Peripherie könnten das keinesfalls entschuldigen.
Bochum handle oft gegen wissenschaftlich begründete Empfehlungen
Steuergeld werde für Gutachten über negative Folgen des Klimawandels verschwendet, ….
„Wir, das Bochumer Klimaschutzbündnis mit seinen Bündnispartnern und Arbeitsgruppen, werfen Politik, Stadtverwaltung und Wirtschaft weitestgehend Versagen beim Schutz zukünftiger Generationen und bereits jetzt lebender Menschen vor. Aber auch jeder einzelne Bürger, wir Mitglieder der verschiedenen Initiativen nehmen uns da nicht aus, ist extrem gefordert, seinen Lebensstil zu überdenken, zu ändern und an den planetaren Grenzen der Erde auszurichten.“
Bochumer Bündnis wurde 2019 gegründet
Das Bochumer Klimaschutzbündnis wurde im September 2019 vom Arbeitskreis Umweltschutz Bochum (AkU) ins Leben gerufen. Der AkU setzt sich seit 1986 für den Klimaschutz ein.
Terminankündigung: Am 16. Dezember findet um 18 Uhr die nächste Telefonkonferenz des Bochumer Klimaschutzbündnisses statt (https://boklima.de).
5. Jahrestag des Pariser Klimaschutzabkommens (7. KNB) ; Berichte
14.12.20 WAZ Bericht
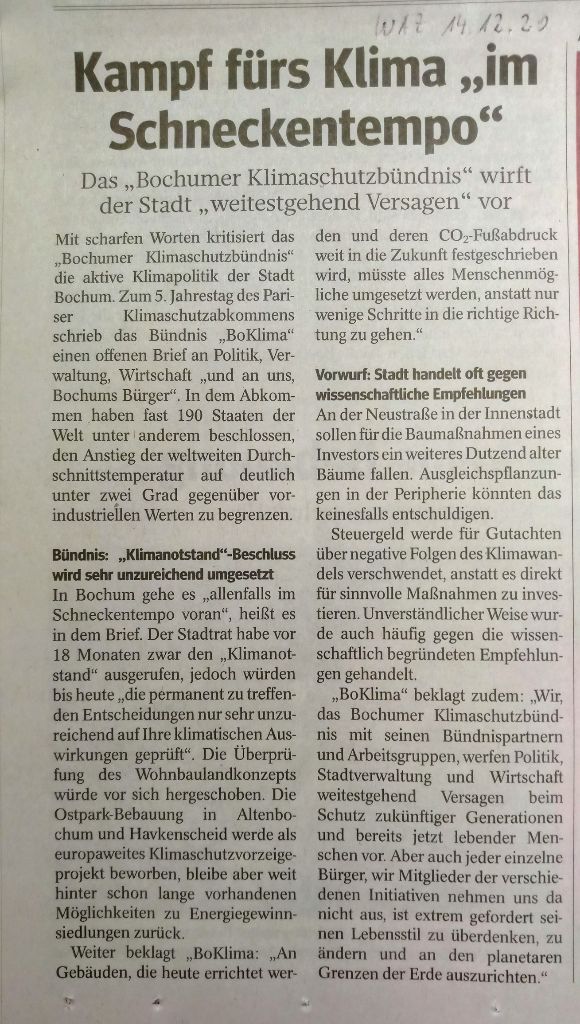
7. KNB – (11.12.20) 5. Jahrestag des Pariser Klimaschutzabkommens
Ein offener Brief des Bochumer Klimaschutzbündnisses an
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und
an uns selbst, Bochums Bürger*innen
5 Jahre Pariser Klimaschutzabkommen…
… und in Bochum geht’s allenfalls im Schneckentempo voran
Vor genau fünf Jahren, am 12.12.2015, haben alle 195 Staaten der Welt das Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart. Damit wurde beschlossen, dass die globale Erwärmung auf deutlich unter 2°C, möglichst auf 1,5°C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau begrenzt werden soll.
Was müsste dafür geschehen?
Die Klimaforscher haben herausgefunden: Um überhaupt eine Chance zu haben, die 1,5-Grad Grenze einzuhalten, darf die Menschheit insgesamt nur noch 600 Gt (Gigatonnen=Milliarden Tonnen) CO2 ausstoßen.
Was heißt das für den Beitrag Deutschlands?
Die Klimaforscher haben errechnet, dass in unserem Gemeinwesen CO2-Minderungen von mindestens -60 Prozent bis 2025 und mindestens -85 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 notwendig sind. Das bedeutet, dass zu Beginn des CO2-Minderungswegs die Absenkung überdurchschnittlich sein muss. Eine gleichmäßige Absenkung bis 2035 genügt nicht!
Und was geschieht in Bochum?
Zwar hat der Stadtrat vor 18 Monaten den Klimanotstand ausgerufen, jedoch werden bis heute die regelmäßig zu treffenden Entscheidungen nur sehr unzureichend auf Ihre klimatischen Auswirkungen geprüft. Die Überprüfung des Wohnbaulandkonzepts wird vor sich hergeschoben, erst in zwei Jahren soll es auf den Prüfstand. Die Ostparkbebauung in Altenbochum und Havkenscheid wird als europaweites Klimaschutzvorzeigeprojekt beworben, bleibt aber weit hinter schon lange vorhandenen Möglichkeiten zur Errichtung von Energiegewinnsiedlungen zurück. An Gebäuden, die heute errichtet werden und deren CO2-Fußabdruck weit in die Zukunft fest geschrieben wird, müsste aber alles menschenmögliche umgesetzt werden, anstatt nur wenige Schritte in die richtige Richtung zu gehen. An der Neustraße in der Bochumer Innenstadt sollen für die Baumaßnahmen eines Investors ein weiteres Dutzend alter Bäume fallen. Ausgleichspflanzungen in der Peripherie können das keinesfalls entschuldigen. Steuergeld wird für Gutachten über negative Folgen des Klimawandels verschwendet, anstatt es direkt für sinnvolle Maßnahmen zu investieren. Es wird unverständlicher Weise häufig gegen die wissenschaftlich begründeten Empfehlungen gehandelt.
Wir, das Bochumer Klimaschutzbündnis mit seinen Bündnispartnern und Arbeitsgruppen, werfen Politik, Stadtverwaltung und Wirtschaft weitestgehend Versagen beim Schutz zukünftiger Generationen und bereits jetzt lebender Menschen vor. Aber auch jeder einzelne Bürger, wir Mitglieder der verschiedenen Initiativen nehmen uns da nicht aus, ist extrem gefordert seinen Lebensstil zu überdenken, zu ändern und an den planetaren Grenzen der Erde auszurichten. Handlungsvorschläge hierzu gibt es unter https://klimaneutral.berlin/tipps/.
Das Bochumer Klimaschutzbündnis wurde im September 2019.vom Arbeitskreis Umweltschutz Bochum (AkU) ins Leben gerufen. Der AkU setzt sich seit 1986 für den Klimaschutz ein.
Terminankündigung: am 16.12.20 findet um 18 Uhr die nächste Telefonkonferenz des Bochumer Klimaschutzbündnisses statt (https://boklima.de/).
Bochum, den 11. Dezember 2020
Gez.: Ihre Bürger*innen des Bochumer Klimaschutzbündnisses
c/o Dr. I. Franke (Sprecher von BoKlima)
AkU e.V., Alsenstraße 27, 44789 Bochum
Mailkontakt: boklima@boklima.de
Homepage: www.BoKlima.de
Kopien: Presseverteiler
EU-Programm Copernicus — Wärmerekord im November
( tagesschau.de ) Stand: 07.12.2020 10:13 Uhr
Seit Beginn der Wetterdatenaufzeichnungen hat es keinen wärmeren November als den vergangenen Monat gegeben. Das meldet das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Es mahnte die Regierungen eindringlich zu mehr Klimaschutz.
Vergangenen Monat ist ein weiterer weltweiter Hitzerekord verzeichnet worden: Es sei der heißeste November seit Beginn der Wetterdatenaufzeichnungen gewesen, teilte das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit. Der Monat sei 0,8 Grad wärmer gewesen als das 30-Jahres-Mittel von 1981 bis 2010.
Der Novemberrekord lag zudem 0,1 Grad über dem letzten Spitzenwert im Jahr 2016. Für die Herbstmonate von September bis November lagen die Temperaturen in Europa 1,9 Grad über dem Vergleichszeitraum.
Milliarden könnten unter Dauerhitze leiden
Laut einer Studie könnten im Jahr 2070 bis zu 3,5 Milliarden Menschen unter dauerhafter Hitze leiden. | 05.05.2020
Gleichauf mit Rekordjahr 2016
“Diese Rekorde stimmen mit dem langfristigen Erwärmungstrend des globalen Klimas überein”, erklärte der Leiter des Copernicus-Dienstes zur Erforschung des Klimawandels, Carlo Buontempo. Das Jahr 2020 liege bislang etwa gleichauf mit dem Rekordjahr 2016.
“Alle politischen Entscheidungsträger sollten diese Aufzeichnungen als Alarmglocken betrachten”, mahnte Buontempo. Sie sollten ernster denn je darüber nachdenken, wie die im Pariser Abkommen von 2015 festgelegten internationalen Verpflichtungen am besten eingehalten werden könnten.
Die Industrie und der Green Deal
Der Streit übers EU-Klimaziel ist in vollem Gang. | 02.12.2020
Das Pariser Klimaabkommen sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad und möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. https://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio-99257~ardplayer_showControlBar-true.html
Heißester November aller Zeiten
Stefanie Markert, ARD Genf
07.12.2020 12:44 Uhr
Download der Audiodatei
Über dieses Thema berichteten am 07. Dezember 2020 Inforadio um 09:23 Uhr und NDR Info um 10:49 Uhr in den Nachrichten.
Mehr zu diesem Thema:
- EU-Klimaziel: Die Industrie und der Green Deal, 02.12.2020
- Studie: Milliarden könnten 2070 unter Hitze leiden, 05.05.2020
( von tagesschau.de , hier )
x
THINK TANK & RESEARCH — Globaler Klima-Risiko-Index 2020
Zusammenfassung
Der Globale Klima-Risiko-Index (KRI) von Germanwatch zeigt, wie stark Länder von Wetterextremen, wie Überschwemmungen, Stürmen, Hitzewellen etc. betroffen sind. Untersucht werden die menschlichen Auswirkungen (Todesopfer) sowie die direkten ökonomischen Verluste. Als Datenbasis dient die weltweit anerkannte Datenbank NatCatSERVICE der Munich RE, unter Einbezug weiterer demographischer (Bevöl-kerungszahl) und wirtschaftlicher Daten (Bruttoinlandsprodukt) des Internationalen Währungsfonds. Germanwatch veröffentlicht den KRI jährlich und in diesem Jahr zum 15. Mal. Im KRI 2020 sind die Ext-remwetterereignisse des Jahres 2018 und für den Zeitraum 1999 bis 2018 erfasst.
Wenngleich die Auswertungen über die Schäden und Todesopfer keine Aussage darüber erlauben, wel-chen Einfluss der Klimawandel bereits bei diesen Ereignissen hatte, so lässt sich doch ein Bild der Ver-wundbarkeit der Staaten zeichnen. Dies kann als Warnsignal verstanden werden, sich auf zukünftig mög-licherweise vermehrte und stärkere Extremwetterereignisse durch Katastrophenvorsorge und Anpassung an den Klimawandel besser vorbereiten zu müssen.
Die Hauptaussagen des KRI 2020
- Japan, die Philippinen und Deutschland waren im Jahr 2018 am stärksten von Extremwetterereignissen be-troffen.
- Im Zeitraum 1999-2018 waren Puerto Rico, Myanmar und Haiti die am stärksten betroffenen Länder.
- Insgesamt kamen zwischen 1999 und 2018 mehr als 495.000 Menschen als direkte Konsequenz von über 12 000 Extremwetterereignissen zu Tode. Die wirtschaftlichen Schäden beliefen sich auf etwa 3,54 Billionen US$ (in Kaufkraftparitäten).
- Hitzewellen waren 2018 eine Hauptursache für Schäden. Von den zehn am stärksten betroffenen Ländern im Jahr 2018 litten Japan, Deutschland und Indien unter einer längeren Hitzeperiode. Jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse haben einen klaren Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Häufigkeit und dem Schweregrad extremer Hitze festgestellt. In Europa z.B. sind extreme Hitzeperioden zwischen 10- und 100-mal wahrscheinlicher als vor einem Jahrhundert. Aufgrund fehlender Daten können die Auswirkungen von Hitze-wellen, z.B. auf dem afrikanischen Kontinent, unterrepräsentiert sein.
- In einigen Fällen (z.B. Puerto Rico) haben einzelne außergewöhnliche Katastrophen so starke Auswirkungen, dass die betroffenen Länder allein dadurch auch im Langzeitindex dauerhaft weit oben platziert sind. In den letzten Jahren hat eine weitere Kategorie von Ländern an Bedeutung gewonnen: Länder wie Haiti, die Philip-pinen und Pakistan werden immer wieder von Katastrophen heimgesucht. Sie gehören sowohl im Langzeit-index als auch im Index des jeweiligen Jahres kontinuierlich zu den am stärksten betroffenen Ländern.
- Von den zehn am stärksten betroffenen Ländern (1999-2018) waren sieben Entwicklungsländer der Länder-gruppe mit niedrigem oder niedrigem mittleren Einkommen, zwei wurden als Land mit hohem mittleren Ein-kommen (Thailand und Dominica) und eines als fortgeschrittene Wirtschaft mit hohem Einkommen (Puerto Rico) eingestuft.
- Der Klimagipfel in Madrid (COP25) muss sich mit der bisher fehlenden zusätzlichen Klimafinanzierung befas-sen, um den ärmsten Menschen und Ländern zu helfen, Schäden und Verluste zu bewältigen. Sie sind am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, weil sie anfälliger für negative Klimawan-delauswirkungen sind und ihnen häufig die finanzielle und technische Kapazität fehlt, um mit Schäden und Verlusten umgehen zu können. Die COP25 muss deshalb Antworten auf drei Fragen finden: Erstens, wie kann der Unterstützungsbedarf der verletzlichen Länder zum Umgang mit Schäden und Verlusten regelmäßig be-stimmt werden? Zweitens, wie können die notwendigen finanziellen Ressourcen generiert und verfügbar ge-macht werden? Drittens, wie kann Anpassung an den Klimawandel besser unterstützt werden, um Schäden und Verluste bereits im Vorhinein zu minimieren.
…

…
( von THINK TANK & RESEARCH , original pdf , hier )
Klimawende – Einwohnerantrag in Bochum
Klimawende – Newsletter 01/2020
Wir starten einen Einwohnerantrag in Bochum
Seit der Auftaktveranstaltung am 26. Februar in der GLS Bank ist viel passiert. Und wir haben unseren Aufruf, die Klimawende von unten mitzugestalten, ernst gemeint und die Zeit zu Hause genutzt.
Viele Videokonferenzen, Recherchen und Diskussionen später haben wir unser Thema gefunden. Wir wollen 100 % Ökostrom bei den Stadtwerken Bochum bis 2025.
2017 stieß die Stadt Bochum insgesamt ca. 2 Mio. Tonnen Treibhausgase aus, wobei die Reduktion der Emissionen seit 2014 annähernd stagniert1 und auch die Ausrufung des Klimanotstands am 06.06.2019 hat daran nicht viel geändert.
Die Stadtwerke Bochum, die zu über 50% der Stadt Bochum gehören, liefern, wenn die EEG-Umlage nicht eingerechnet ist, aktuell Strom, dessen Gesamtmix nur zu etwa 38 % aus erneuerbaren Quellen stammt2. Wir denken, dass Bochum hier eine Vorreiterrolle einnehmen und die Stadtwerke anweisen sollte, diesen Anteil auf 100% auszubauen.
Deshalb haben wir letzte Woche einen Einwohnerantrag zur Vorprüfung bei der Stadt eingereicht. Nach Gesprächen mit den Parteien Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen sowie dem Erscheinen des Koalitionsvertrags letzterer mit der SPD haben wir uns entschlossen mit dem Bürgerbegehren noch zu warten und stattdessen einen kleineren Schritt zu machen. Der Koalitionsvertrag3 von SPD und Grünen für Bochum sieht vor, dass die Stadtwerke den Anteil erneuerbaren Stroms bis 2022 auf 75% erhöht. Da die Politik das Thema Ökostrom schon selbst ins Programm aufgenommen hat, sind wir sicher mit unserem Vorhaben erfolgreich zu sein. Mit unserem Einwohnerantrag wollen wir deshalb die Stadt dazu bringen, das Thema so schnell wie möglich zu behandeln und nicht nur als Papiertiger in den Schubladen der Demokratie enden zu lassen. Wir wollen, dass die Koalition ihre Wahlversprechen ernst nimmt und gehen sogar noch einen Schritt weiter und fordern ganze 100 % Ökostrom für Bochum.
Ein Einwohnerantrag bewirkt, dass sich der Stadtrat innerhalb von vier Monaten mit dem Thema befassen muss. Im Gegensatz zum Bürgerbegehren gibt es jedoch ein paar andere Regeln. Für einen Einwohnerantrag brauchen wir 8.000 Unterschriften von Menschen, die seit mindestens 3 Monaten in Bochum ihren Erstwohnsitz haben und mindestens 14 Jahre alt sind. Für ein Bürgerbegehren wären 12.000 Unterschriften von Einwohner*innen ab 16 Jahren nötig.
Spoiler-Alarm: Schaut doch gern mal auf unserer Homepage vorbei. Bald findet ihr dort noch mehr Fakten zu dem Thema: www.klimawende-bochum.de. Spoiler Nummer zwei: Der Einwohnerantrag soll natürlich nicht unser einziges Vorhaben bleiben. Hinter den Kulissen wird schon ein Bürgerbegehren zur Wärmeversorgung geplant.
Du findest uns gut? Dann folge und like uns auch gern in den sozialen Medien.
Wir können jeden Like und Retweet und Unterstützung gebrauchen. Ab März 2021 wollen wir, nach hoffentlich erfolgreicher Vorprüfung, mit der Sammlung der Unterschriften beginnen. Jeder Mensch ist herzlich willkommen mitzumachen, ob als Einzelperson oder als Sammelstelle.
Meldet euch bei uns!
Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit.
Kontakt : www.klimawende-bochum.de , info@klimawende-bochum.de
- Antwort der Verwaltung, https://session.bochum.de/bi/vo0050.asp?__kvonr=7074132
- Eigene Berechnungen nach Angaben der Stadtwerke Bochum. https://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/produkte/strom-erdgas/strommix
- https://gruene-bochum.de/wp-content/uploads/sites/29/2020/10/Entwurf_Koalitionsvertrag_29.10.2020.pdf (abgerufen am 22.11.2020)
Die Klima-Community startet (correctiv.org)
Ein Ort für die Klima-Community
Mit unserer Klimaredaktion möchten wir Konstruktiven Journalismus in Zeiten der Klimakrise vorantreiben. Dafür braucht es das Zusammenkommen von Bürgerinnen, Experten und Initiativen. Zu diesem Zweck ist heute unsere Web-App „klima-community“ gestartet. Ein Ort, an dem Menschen insbesondere aus dem Ruhrgebiet sich zusammenfinden und Probleme, Visionen und Lösungen miteinander diskutieren können.
Die klima.community startet (CORRECTIV)
CORRECTIV hat mit klima.community eine Netzwerkplattform für das Ruhrgebiet entwickelt, mit der sich lokale Initiativen und Experten des Ruhrgebiets vernetzen und eine größere Öffentlichkeit erreichen können. klima.community ist ein offenes Verzeichnis für alle Initiativen und Experten, die sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Mobilität und Umweltschutz befassen. Über die Plattform können gemeinsam Veranstaltungen geplant, Mitveranstalter eingeladen und Profile angelegt werden. Das Projekt wird von der Mercator Stiftung gefördert.
Stationen für überschüssige Lebensmittel, Kleidertauschbörsen oder die nächste Fahrrad-Demo – interessierte Menschen sehen auf einen Blick, wer sich in ihrer oder einer anderen Stadt für welches Thema stark macht. Sie können Initiativen, Experten und Veranstaltungen vorschlagen oder selbst die nächste Aktion organisieren. Wer sich in seiner Stadt engagieren möchte, hat einen schnellen Überblick und kann sich vernetzen – die Planung wird einfacher und die Wirkung größer.
Nutzerinnen und Nutzer können die große Bandbreite an Bürgerinitiativen, Veranstaltungen und Experten auf klima.community durchforsten, ohne sich anzumelden. Die Inhalte sind übersichtlich nach Themenfeldern und Städten geordnet. klima.community ist eine sogenannte Progressive-Web-App. Das bedeutet, dass sie einfach über den Browser genutzt werden kann. Nutzer können interessante Veranstaltungen und Projekte speichern und mit wenigen Klicks einen individuellen Kalender erstellen, ohne sich ein Programm herunterladen zu müssen
( mehr bei correctiv.org : hier )