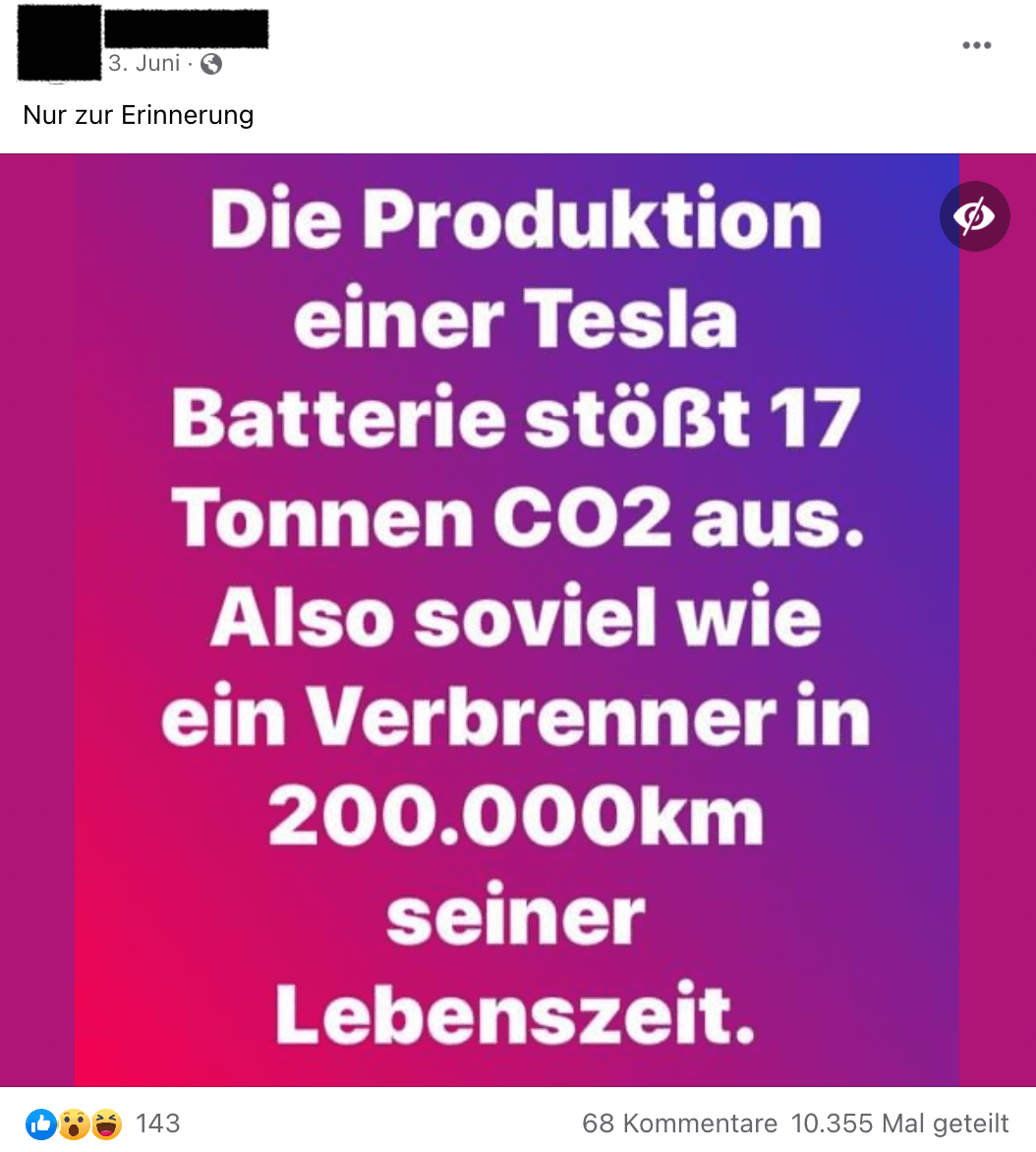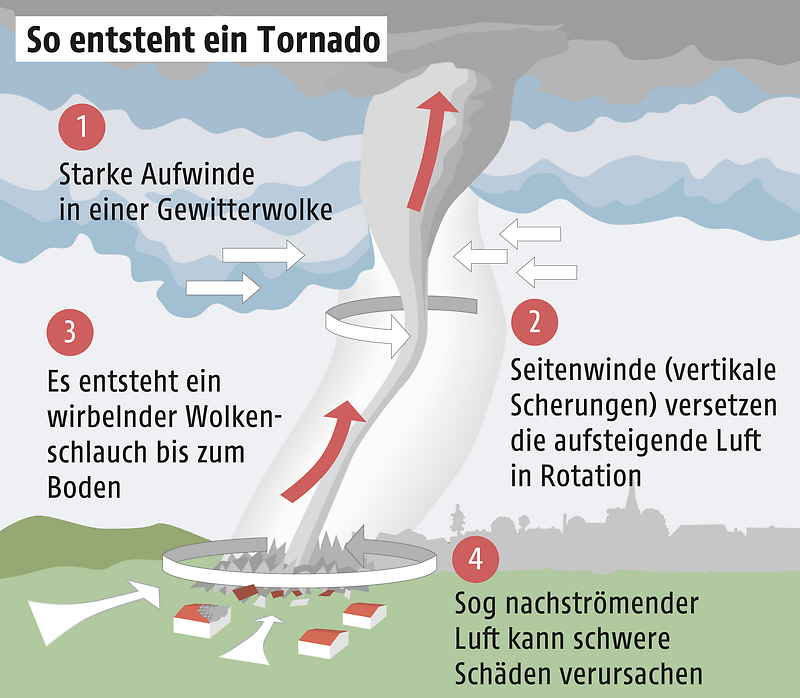(04.07.21, aus ‘Die Zeit’ , Original : hier )
Wir wissen, was zu tun ist, aber begreifen die Gefahr nicht, sagt die Risikoforscherin Pia-Johanna Schweizer.
Warum sich der Klimawandel nicht so leicht bekämpfen lässt. Interview: Alexandra Endres
“Hohe Spritpreise spürt man sofort, der Klimawandel kommt schleichend” – Seite 1
Der Klimawandel ist kein Thema unter wichtigen anderen, sondern bedingt viele Risiken unserer Zeit. Das macht träge, angemessen auf ihn zu reagieren, sagt die Risikoforscherin Pia-Johanna Schweizer. Wie lässt sich das ändern? Ein Gespräch über Ausnahmesituationen und vermeintliche Wege aus der Krise, die gleich wieder neue Probleme schaffen
Pia-Johanna Schweizer
leitet am Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam die Forschungsgruppe Systemische Risiken. In ihrer Promotion beschäftigte sich die Soziologin mit der Frage, wie gesellschaftliche Diskurse dazu beitragen können, Risiken einzuhegen.
ZEIT ONLINE: Frau Schweizer, wann haben Sie sich selbst zuletzt in eine riskante Situation begeben?
Pia-Johanna Schweizer: Erst vor ein paar Stunden. Ich habe heute um 12.30 Uhr meine erste Corona-Impfung erhalten und mich sehr darauf gefreut.
ZEIT ONLINE: Obwohl Sie die Impfung als riskant ansehen?
Schweizer: Für mich selbst bewerte ich das Risiko von Nebenwirkungen als gering. Und den Nutzen der Impfung nehme ich gern in Anspruch. Der formale Umgang mit Impfrisiken ist in Deutschland sehr genau geregelt und sie sind durch klinische Studien recht gut erforscht – ebenso wie übrigens das Risiko, sich ungeimpft mit Covid-19 anzustecken, mit allen möglichen Folgen.
ZEIT ONLINE: Sie erforschen systemische Risiken, die ungleich komplexer und schwieriger zu verstehen und abzuwägen sind. Was genau ist das, ein systemisches Risiko?
Schweizer: Es gibt Risiken, deren Ursachen und Wirkungen sich klar verbinden lassen. Mit ihnen umzugehen, ist relativ einfach. Zum Beispiel im Autoverkehr: Geschwindigkeitsbegrenzungen und andere Verkehrsregeln helfen, die Zahl der Verkehrstoten zu senken. Oder am Arbeitsplatz. Dort reduzieren Arbeitsschutzbestimmungen das Risiko von Unfällen. Systemische Risiken sind anders. Newsletter
Sie lösen Wechselwirkungen und Rückkopplungen aus. Deshalb sind sie schwer zu verstehen und noch schwerer zu beherrschen. Sobald man meint, ein systemisches Risiko zu bewältigen, hat man sich zwei neue eingehandelt. Sie lassen sich nicht eingrenzen, weder räumlich – also auf eine bestimmte Region – noch inhaltlich – also auf ein bestimmtes Politikfeld.
ZEIT ONLINE: Geben Sie bitte ein Beispiel.
Schweizer: Die Corona-Pandemie. Das Virus hat sich rapide über den ganzen Erdball ausgebreitet und seine Auswirkungen betreffen nicht nur das Gesundheitssystem, sondern vielerlei andere wichtige Systeme der Gesellschaft: die Lebensmittelversorgung, das Wirtschafts- und Finanzsystem, die Bildung, die Möglichkeit zur Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben. Und der Klimawandel ist vielleicht das beste Beispiel für ein weiteres systemisches Risiko.
ZEIT ONLINE: Eine gängige Definition von Risiko ist: Man schaut sich die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Ereignis eintritt, und multipliziert sie dann mit dem zu erwartenden Schaden. Ließe sich das Risiko, das der Klimawandel für Deutschland birgt, auf diese Art beziffern?
Schweizer: Das wäre zu einfach. Das Risiko des Klimawandels ist sehr komplex. Wir können zwar abschätzen, wie sich das Klima in verschiedenen deutschen Regionen über die Zeit hinweg entwickeln könnte. Aber wie das Leben der Menschen in Mecklenburg in 50 Jahren aussieht, hängt von sehr vielen Faktoren ab, auch davon, wie die Politik auf den Klimawandel reagiert – und ob die Menschen diese Maßnahmen akzeptieren.
ZEIT ONLINE: Zumindest für die nahe Zukunft lässt sich doch aber relativ genau abschätzen, welche klimatischen Veränderungen auf die deutschen Regionen zukommen. Die Treibhausgase sind ja bereits in der Luft.
Schweizer: Es stimmt, dass wir enorm viel über den Klimawandel wissen. Aber als Gesellschaft tun wir uns schwer, angemessen auf die Risiken zu reagieren, die der Klimawandel mit sich bringt – dabei wird genau von unserer Reaktion abhängen, wie groß der Schaden sein wird, den er letztlich in Deutschland anrichtet.
ZEIT ONLINE: Warum können wir als Gesellschaft nicht so leicht reagieren?
Schweizer: Jedes Individuum nimmt die Realität auf eigene Weise wahr. Daraus eine gemeinsame Risikoabschätzung für die Gesellschaft zu entwickeln, ist kaum möglich. Ich komme beispielsweise aus einer sehr technikgläubigen Familie, in der man stark darauf vertraut, dass man schon eine technische Lösung gegen den Klimawandel finden wird. Durch mein Soziologiestudium habe ich aber eine ganz andere Perspektive. Ich bin eher darauf trainiert, die Dinge kritisch zu hinterfragen. Und dadurch, dass ich seit Jahren zu systemischen Risiken forsche, achte ich ganz genau auf Zusammenhänge: Welche Risiken können weitere Risiken auslösen – oder gar positive Auswirkungen haben?
“Ein Einzelner kann den Klimawandel nicht so leicht beeinflussen”
ZEIT ONLINE: Wie reagieren Sie persönlich auf das Risiko des Klimawandels?
Schweizer: Ich lasse das Auto stehen, wenn ich es nicht unbedingt brauche, und bald will ich es ganz abschaffen. Ich versuche, bewusst zu konsumieren. Den CO2-Ausstoß meiner Einkäufe lasse ich mir von einer App berechnen. Sonst hätte ich gar keine Vorstellung davon, wie viele Treibhausgase beispielsweise die Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts verursacht, das ich für meine Kinder kaufe.
ZEIT ONLINE: Reicht das aus? Gegen ein systemisches Risiko wie den Klimawandel bräuchte es doch gesamtgesellschaftliche Maßnahmen.
Schweizer: Es braucht ein Maßnahmenbündel, das Anreize bietet, dass Individuen ihr Handeln an Maximen der sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit ausrichten. Zudem ist eine gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeitstransformation notwendig. Mit der Energiewende ist Deutschland bereits auf dem richtigen Weg, auch wenn noch eine längere Strecke vor uns liegt bis zu Netto-Nullemissionen.
ZEIT ONLINE: Welche Rolle spielt es, wie stark man selbst von einem Risiko betroffen ist?
Schweizer: Ich denke, es ist wichtig, ob jemand bereits Erfahrungen mit einem bestimmten Risiko gesammelt hat, beispielsweise mit einer Pandemie. Corona wurde zu Beginn in Deutschland noch von vielen unterschätzt.
ZEIT ONLINE: Verhält es sich mit der Klimakrise vielleicht ähnlich? Lange dachte man, Deutschland sei kaum betroffen. Dass das nicht stimmt, ist mittlerweile klar, aber statt darüber zu diskutieren, wie man dem am besten begegnet, streiten wir über den Benzinpreis.
Schweizer: Dafür gibt es Gründe. Höhere Spritpreise spürt man sofort im Portemonnaie, der Klimawandel aber kommt schleichend. Manche freuen sich womöglich auch auf längere, ausgedehnte Sommer. Ursache und Wirkung des Klimawandels klaffen zeitlich und räumlich stark auseinander, und auch die Frage, wer Verantwortung für den Klimawandel trägt, ist nicht so eindeutig zu beantworten wie beispielsweise die Frage nach den Schuldigen an einem Chemieunfall. Das beeinflusst unsere Risikowahrnehmung eklatant.
Thema: Spritpreise: Wie teuer wird Autofahren nach der Wahl? Ökonomie: Keine Selbstbedienung, bitte!
ZEIT ONLINE: Aber die entscheidenden Punkte stehen doch außer Frage. Der Klimawandel ist gut erforscht. Er ist real, er ist menschengemacht, er bringt uns in Gefahr. Wir können etwas gegen ihn tun, indem wir aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, Wälder abzuholzen, Feuchtgebiete trockenzulegen. Und selbst wenn wir dazu auf manches verzichten müssen: Menschen schränken sich ebenfalls ein, um ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen oder um aufs Eigenheim zu sparen. Warum fällt uns das in der Klimapolitik so schwer?
Schweizer: Ein Häuslebauer weiß ganz genau, für wen er spart und mit welcher Strategie er zu seinem Eigenheim kommt. Das Risiko Klimawandel ist im Vergleich dazu kaum zu begreifen. Ein Einzelner kann den Klimawandel nicht so leicht beeinflussen und die Informationen über ihn sind oft widersprüchlich. Deshalb fällt es uns schwer, ihn zu begreifen. Einmal steht das Fliegen im Fokus, dann die Kohle, dann wieder die globale Zementindustrie. Und wie der oder die Einzelne dann darauf reagiert, hängt stark vom sozialen Umfeld ab. Eine Studentin in der Stadt positioniert sich anders als ein Arbeitnehmer auf dem Land, der täglich weite Strecken mit dem Auto pendelt. Und viele Familien können sich den Luxus höherer Benzinpreise unter den derzeitigen Rahmenbedingungen schlicht nicht leisten.
ZEIT ONLINE: Klar, Klimaschutz kostet. Aber kein Klimaschutz ist doch noch viel teurer.
Schweizer: Aber wer zahlt? Die Schäden des Klimawandels treffen die künftigen Generationen. Das macht es schwer, heute zu guten Entscheidungen zu kommen.
Thema: Anders Levermann: Wie verbietet man richtig, Herr Levermann?
ZEIT ONLINE: Ändert sich das, sobald wir die Folgen des Klimawandels stärker spüren?
Schweizer: Ich finde, es gibt eine Sache, die die Corona-Pandemie gezeigt hat: In einer Krise sind viele Menschen in der Lage, mit großer Disziplin harte Einschränkungen in Kauf zu nehmen, sofern sie überzeugt sind, dass es etwas bringt. Aber irgendwann erschöpft sich das. Die Krise wird zur Routine. Die Menschen gewöhnen sich an die neue Situation und sind dann auch bereit, höhere Risiken einzugehen, um sich wieder so verhalten zu können wie zuvor. Ähnlich könnte es mit dem Klimawandel sein.
ZEIT ONLINE: Grüne, SPD und selbst die FDP versprechen einen sozialen Ausgleich für höhere Benzinpreise. Kann es sein, dass viele das in einer stark polarisierten Debatte gar nicht mitbekommen?
Schweizer: Ich denke schon, dass die Leute es mitbekommen. Vielleicht fehlt es am Vertrauen in die Politik. Wahlkampfversprechen werden nicht immer gehalten. Und in einer repräsentativen Demokratie wie der unsrigen haben die Bürgerinnen und Bürger eben viel weniger direkte Einflussmöglichkeiten als beispielsweise in der Schweiz, wo jeder mitentscheiden kann. Das ändert auch die Risikowahrnehmung und -akzeptanz. Wer an Entscheidungen beteiligt ist, fühlt sich eher für die Folgen verantwortlich.
ZEIT ONLINE: Volksabstimmungen mögen gut sein, weil sie den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden. Eignen sie sich auch, um sinnvolle Lösungen für komplexe Probleme zu finden?
“Ich habe großes Zutrauen, vor allem in die jüngere Generation”
Schweizer: Bürgerbeteiligung funktioniert ja nicht nur über reine Abstimmungen. Eine andere Form sind Bürgerräte, die sich im Austausch mit Fachleuten eine fundierte Meinung zu einem bestimmten Thema bilden und dann die Politik beraten. Wir müssen die Debatte über mögliche Wege aus der Krise aber auf allen Ebenen führen: im Parlament, wo die Gesetze beschlossen werden; in Bürgerräten und anderen Beteiligungsformaten; mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft; mit Vertreterinnen und Vertretern aller anderen betroffenen Gruppen.
Thema: Bürgerrat Klima: Mit ihnen soll Deutschland klimafreundlich werden Bürgerrat Klima: Was wollen die Bürger sich zumuten?
ZEIT ONLINE: Das klingt sehr unübersichtlich. Wie lässt sich so etwas organisieren?
Schweizer: Das hängt davon ab, um welches Problem es konkret geht. Beim Bau von Windkraftanlagen an Land beispielsweise sind die Zuständigkeiten und die Betroffenen recht klar. In den Kommunen kann man die Menschen leichter beteiligen als in abstrakten Debatten über eine unübersichtliche, komplexe, riesenhafte Krise.
ZEIT ONLINE: Sie haben gesagt, wenn man ein systemisches Risiko in den Griff bekommt, können sich dafür zwei neue auftun. Wie lässt sich das verstehen?
Schweizer: Zum Beispiel haben die Schulschließungen in der Corona-Pandemie zwar das Ansteckungsrisiko eingehegt. Aber sie hatten Bildungsdefizite und auch psychische Probleme bei vielen Kindern und Jugendlichen zur Folge.
ZEIT ONLINE: Wie ist es in der Klimapolitik?
Schweizer: Da gibt es ähnliche Mechanismen. Wenn die Benzinpreise steigen und es keinen finanziellen Ausgleich dafür gibt, können neue soziale Nachteile entstehen, etwa für Haushalte mit geringem Einkommen, die auf ein Auto angewiesen sind. Die Transformation des Energiesystems birgt ebenfalls Risiken. In Zukunft werden beispielsweise Stromangebot, -speicherung und -nachfrage noch stärker digital reguliert werden müssen als bisher, damit es nicht zu Ausfällen kommt. Damit steigt die Anfälligkeit für Hackerangriffe. Für systemische Risiken gibt es keine schnellen, einfachen Lösungen.
ZEIT ONLINE: Haben wir überhaupt eine Chance, ein systemisches Risiko wie den Klimawandel zu stoppen?
Schweizer: Ich habe da großes Zutrauen, vor allem in die jüngere Generation. Es gibt da eine große politische Mobilisierung und viel Gestaltungswillen – und zugleich das Wissen, dass es ganz unterschiedliche Wertvorstellungen gibt und eben nicht den einzig richtigen Weg, um alle glücklich zu machen. Ich denke, das sind gute Voraussetzungen.
tip von Ingo


 Falsch
Falsch