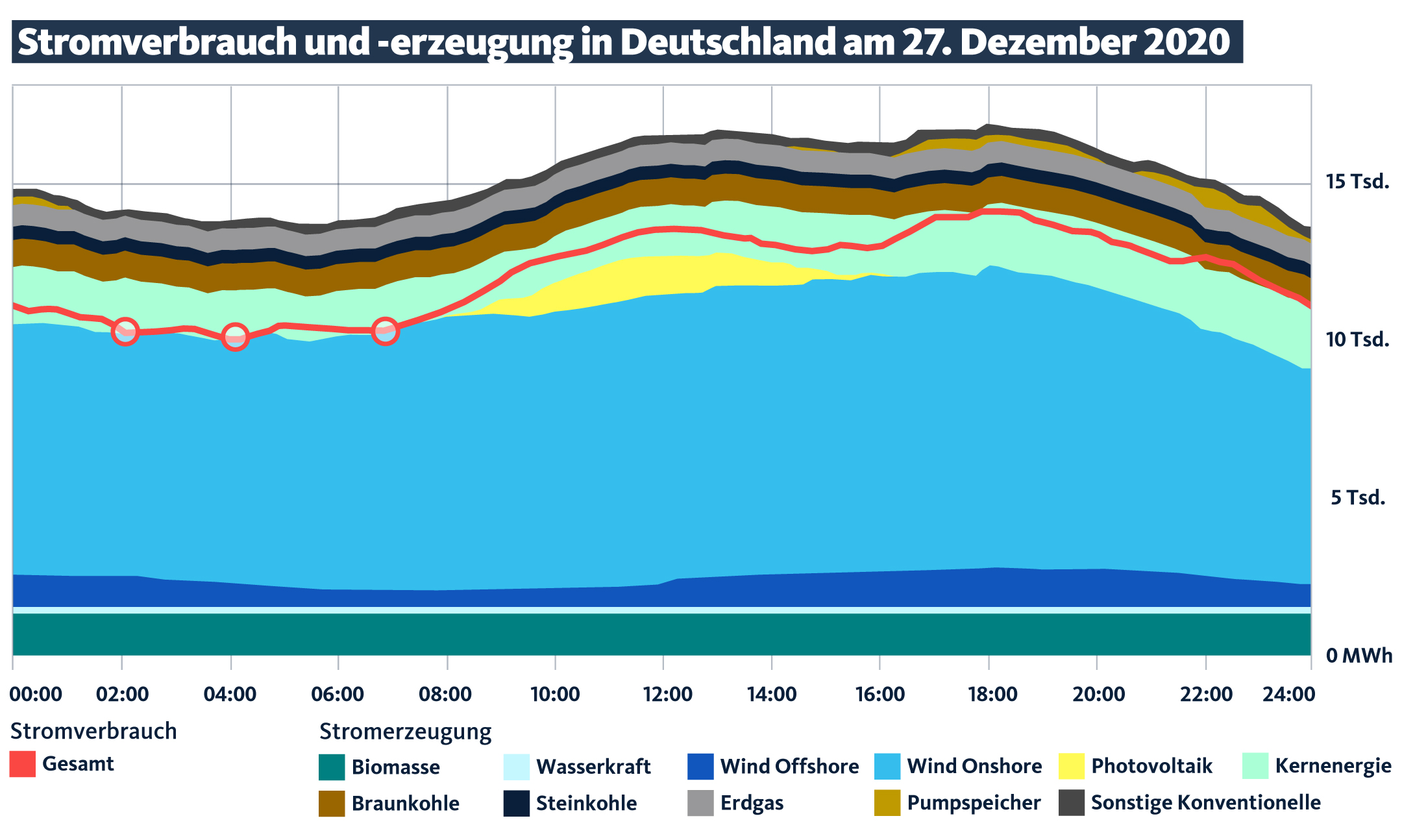Die Waldzerstörungs-Weltrangliste
( 14.04.21 , Original vom WWF.de : hier )
Die EU zählt zu den größten Treibern von Waldzerstörung. Das zeigt ein heute veröffentlichter WWF-Report, der die Auswirkungen von Handelsbeziehungen auf die Entwaldung und Naturzerstörung von 2005 bis 2017 untersucht. 16 Prozent der globalen Tropenabholzung im Zusammenhang mit dem internationalen Handel gehen demnach auf das Konto der EU. Sie liegt damit auf Platz zwei der „Weltrangliste der Waldzerstörer“, hinter China (24 Prozent) und vor Indien (9 Prozent) und den USA (7 Prozent).
Der WWF fordert die Bundesregierung sowie die EU-Kommission auf, Verantwortung zu übernehmen und als Konsequenz aus dem Report für bessere und verbindliche Umwelt- und Sozialstandards in den internationalen Handelsbeziehungen zu sorgen. Als ersten Schritt fordert der WWF die Bundesregierung auf, sich bei der EU-Kommission für ein starkes EU-Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten einzusetzen. Es muss verhindern, dass für unseren Konsum weiter intakte Natur wie Wälder, Savannen und Feuchtgebiete in Ackerflächen umgewandelt werden.
Christine Scholl, WWF-Expertin für nachhaltige Lieferketten, kommentiert: „Die Ära der Naturzerstörung muss enden, denn natürliche Ökosysteme wie Wälder sind unsere Lebensversicherung. Sie sind Klimaretter, eine Schatzkammer der Artenvielfalt und ein Bollwerk gegen künftige Pandemien. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel im globalen Handel: Produkte, die auf dem europäischen Markt landen, dürfen nicht auf Kosten von Natur und Menschenrechten produziert werden.“
Am meisten tropischen Wald zerstörten im Untersuchungszeitraum die Importe von Soja, Palmöl und Rindfleisch, gefolgt von Holzprodukten, Kakao und Kaffee. In Brasilien, Indonesien und Paraguay vernichtete der EU-Konsum am meisten Waldfläche. Durch die importierte Entwaldung verursachte die EU 2017 indirekt 116 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Das entspricht mehr als einem Viertel der EU-Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft im selben Jahr. Diese indirekten Emissionen werden in den offiziellen Statistiken zu Treibhausgas-Emissionen nicht erfasst.
Innerhalb der EU importierte Deutschland zwischen 2005 und 2017 mit Abstand am meisten Entwaldung, durchschnittlich wurden jährlich 43.700 Hektar Wald für deutsche Importe vernichtet. Insgesamt fallen 80 Prozent der importierten Waldzerstörung in der gesamten EU auf die acht größten Volkswirtschaften zurück. Scholl kommentiert: „Es ist ein Teufelskreis, denn intakte Natur ist die Grundlage jeder langfristig erfolgreichen Wirtschaft. Freiwillige Absichtserklärungen von Regierungen und Unternehmen, Lieferketten entwaldungsfrei zu gestalten, stoppen Naturzerstörung bisher nur in Einzelfällen. Umso wichtiger ist es, dass die EU-Kommission mit einem zielführenden und ambitionierten Gesetz einen verbindlichen Rahmen setzt.“
Neben Wäldern müsse dieses Gesetz auch andere Ökosysteme schützen, so der WWF, sonst verlagere sich die Naturzerstörung nur vom Wald auf andere Ökosysteme wie Feuchtgebiete, Grasland und Savannen. Diese sind für Klima, Artenvielfalt und den Lebensunterhalt von Menschen vor Ort allerdings genauso wichtig wie tropische Wälder und stehen jetzt schon unter enormen Druck: Laut WWF-Recherche stammten 2018 fast ein Viertel der EU-Sojaimporte aus den untersuchten südamerikanischen Ländern aus der Cerrado-Savanne, wo die Zerstörung des Ökosystems zugunsten landwirtschaftlicher Nutzung besonders stark voranschreitet.
Laut einer kürzlich veröffentlichten WWF-Ernährungsstudie kann auch ein Ernährungswandel dazu beitragen, den Entwaldungsdruck auf die Regenwälder zu senken: Halbiert sich der Fleischkonsum aller Deutschen auf im Schnitt 470 Gramm pro Woche – zugunsten von mehr Hülsenfrüchten und Nüssen – sinkt damit auch Deutschlands ernährungsbedingter Flächenbedarf um fast drei Millionen Hektar. Das entspricht in etwa der Größe Brandenburgs.
Hintergrund: Methode
Der Report „Stepping up: The continuing impact of EU consumption on nature“ wurde vom WWF erstellt. Er basiert auf Daten und Erkenntnissen aus Satellitenbildanalysen und Untersuchungen von Handelsströmen, die vom Stockholmer Umweltinstitut (SEI) und der Transparenzinitiative Trase zusammengestellt wurden. Für die Darstellungen wurden Datensätze von Pendrill et al. (2020) genutzt, um die Rolle von EU-Importen und -Konsum bei der tropischen Entwaldung sowie die dazugehörigen Emissionen darzustellen. Ein Datensatz von Trase (2020) wurde genutzt, um ein räumlich explizites Bild von Rohstofflieferketten zu erstellen. Hier wurde die regionale bzw. Ökosystem-spezifische Entwaldung bzw. Umwandlung natürlicher Ökosysteme in Südamerika (Brasilien, Argentinien, Paraguay) mit EU-Importdaten verknüpft. Zusätzlich wurden Daten von Trase (2019) genutzt, um freiwillige Selbstverpflichtungen von Exporteuren mit Handelsmengen zu verknüpfen.
Downloads
WWF-Report: Stepping Up? Summary Report. [PDF | 18MB]
WWF-Report: Stepping Up? Full Report. [PDF | 40MB]
Kontakt Rebecca Gerigk , Pressesprecherin, Berlin
Weiteres Material :
TAZ.de
(original bei Taz.de : hier )
Tropenwald-Abholzung durch Importe: EU ist zweitgrößter Waldzerstörer
Für den Konsum in Europa werden anderswo Wälder gerodet. Die EU hält einen Spitzenplatz in der WWF-Weltrangliste. Auch Deutschland mischt kräftig mit.
Tropenwald-Abholzung durch Importe: Die EU liegt laut WWF weltweit auf Platz zwei Foto: DPA
BRÜSSEL/BERLIN dpa | Soja, Rindfleisch, Kaffee: Damit Kunden in europäischen Supermärkten solche Produkte kaufen können, müssen in anderen Weltregionen Wälder weichen. Für EU-Importe wurden zuletzt pro Jahr durchschnittlich Tropenwälder von der vierfachen Größe des Bodensees gerodet. Im Jahr 2017 gingen weltweit 16 Prozent der Abholzung von Tropenwald im Zusammenhang mit Handel auf das Konto von EU-Importen, wie ein am Mittwoch vorgestellter Bericht der Umweltorganisation WWF für die Jahre 2005 bis 2017 feststellt.
Die Europäische Union liegt damit hinter China (24 Prozent) und vor Indien (9 Prozent) und den USA (7 Prozent) weltweit auf Platz zwei dieser „Weltrangliste“. Innerhalb der EU steht Deutschland ganz oben auf der Liste.
Die mit Abstand größten Verursacher von Abholzung durch EU-Importe waren dem Bericht zufolge Soja (rund 31 Prozent der gerodeten Fläche) und Palmöl (rund 24 Prozent), für deren Anbau oder Produktion vor allem Wälder in Südamerika beziehungsweise Südostasien weichen mussten. Dahinter folgten Rindfleisch, Holzprodukte, Kakao und Kaffee.
Unter den EU-Ländern ist Deutschland für die meiste Abholzung durch Importe verantwortlich: Im Schnitt wurden dafür pro Jahr 43.700 Hektar Wald gerodet – eine Fläche etwa halb so groß wie Berlin. Nach Einwohnern gerechnet liegt Deutschland allerdings in etwa im EU-Schnitt. Der meiste Wald pro Einwohner wurde für Importe in die Niederlande, nach Belgien und Dänemark gerodet.
Rodungen betreffen auch das Weltklima
Die Rodungen machen sich dem Bericht zufolge nicht nur in Ökosystemen weit weg von Europa bemerkbar, sondern betreffen auch das Weltklima. Durch die importierte Entwaldung habe die EU 2017 indirekt 116 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verursacht, heißt es in dem WWF-Bericht. Das entspreche mehr als einem Viertel der EU-Emissionen aus der Landwirtschaft im selben Jahr. Solche indirekten Emissionen würden in den Statistiken zu Treibhausgas-Emissionen nicht erfasst.
Der Bericht zeigt jedoch auch, dass die EU die durch Importe verursachte Waldzerstörung von 2005 bis 2017 um 40 Prozent reduziert hat. 2005 machte der EU-Anteil weltweit noch 31 Prozent aus, Europa lag bis 2013 auf Platz eins der „Weltrangliste der Waldzerstörer“, wie es der WWF in dem Bericht formuliert. Selbstverpflichtungen von Unternehmen und Regierungen hätten in einigen Fällen zwar etwas gebracht. Erfolgreich seien sie letztlich aber nicht gewesen. Denn: Das erklärte EU-Ziel, die Entwaldung bis 2020 zu stoppen, wurde nicht erreicht.
Der WWF fordert deshalb EU-Gesetze mit verbindlichen Regeln. Das Europaparlament hat die EU-Kommission bereits im Oktober 2020 dazu aufgefordert, einen Rechtsrahmen vorzulegen, um die von der EU verursachte globale Abholzung zu stoppen.
Verbindliche Anforderungen nötig
Entscheidend sei, dass es verbindliche Anforderungen an Unternehmen und den Finanzsektor gebe, fordert die Stiftung. Rohstoffe müssten zurückzuverfolgen, Lieferketten transparent sein. Die nationale Gesetzgebung der EU-Staaten sollte effektive und abschreckende Sanktionen wie Geldstrafen für Betreiber und Händler oder die Beschlagnahmung von Waren vorsehen, wenn Bestimmungen nicht eingehalten werden. Zentral sei außerdem, sich nicht etwa an den Regeln der exportierenden Länder zu orientieren – denn nach den Gesetzen vor Ort können die Rodungen durchaus legal sein.
„Die Ära der Naturzerstörung muss enden, denn natürliche Ökosysteme wie Wälder sind unsere Lebensversicherung“, sagte Christine Scholl, die beim WWF für nachhaltige Lieferketten zuständig ist. „Produkte, die auf dem europäischen Markt landen, dürfen nicht auf Kosten von Natur und Menschenrechten produziert werden.“ Denn obwohl sich der am Mittwoch vorgestellte Bericht mit Rodungen befasst – allein auf die Wälder darf sich die EU bei der Gesetzgebung nicht konzentrieren, wenn es nach dem WWF geht. Dann könnten andere Probleme ignoriert werden, etwa Menschenrechtsverletzungen oder die Zerstörung anderer Ökosysteme wie Savannen, Grasland und Feuchtgebiete.
Konsum sollte hinterfragt werden
Auf die Schultern der Konsumenten will der WWF die Aufgabe nicht geladen wissen, das Ausmaß der Rodungen zu reduzieren. Es solle vielmehr eine Selbstverständlichkeit sein, dass das, was auf den Tellern lande, nicht mit der Zerstörung des Planeten oder der Verletzung von Menschenrechten zusammenhänge, sagt Anke Schulmeister-Oldenhove vom WWF, die Hauptautorin des Berichts. Darüber hinaus könne aber durchaus der eigene Konsum – etwa von Fleisch – und dessen Folgen hinterfragt werden.
Für den Bericht wurden Daten zur Abholzung – zum Beispiel Satellitenbilder – mit Daten zum internationalen Handel verknüpft. Ergebnisse für die Zeit nach 2017 liegen laut WWF noch nicht vor. Der Bericht bezieht sich also auf die EU inklusive Großbritanniens.
ZDF
( von zdf.de , Original : hier )
WWF-Bericht – EU ist weltweit zweitgrößter Waldzerstörer
Datum: 14.04.2021 06:26 Uhr
Die Europäische Union ist weltweit zweitgrößter Waldzerstörer für Importe. Das geht aus einem Bericht des WWF hervor. Und Deutschland liegt in Europa ganz weit vorne
Video
Der Waldbericht der Umweltschutzorganisation WWF fällt katastrophal aus. Für Export und Ladwirtschaft werden tropische Wälder gerodet – Europa ist nach China auf dem 2. Platz. Beitragslänge: 1 min Datum: 14.04.2021
Soja, Rindfleisch, Kaffee: Damit Kunden in europäischen Supermärkten solche Produkte kaufen können, müssen in anderen Weltregionen Wälder weichen.
EU zweiter der “Weltrangliste der Waldzerstörer”
Für EU-Importe wurden zuletzt pro Jahr durchschnittlich Tropenwälder von der vierfachen Größe des Bodensees gerodet. Im Jahr 2017 gingen weltweit 16 Prozent der Abholzung von Tropenwald im Zusammenhang mit Handel auf das Konto von EU-Importen, wie ein am Mittwoch vorgestellter Bericht der Umweltorganisation WWF für die Jahre 2005 bis 2017 feststellt.
Die Europäische Union liegt damit hinter China (24 Prozent) und vor Indien (9 Prozent) und den USA (7 Prozent) weltweit auf Platz zwei dieser “Weltrangliste”. Innerhalb der EU steht Deutschland ganz oben auf der Liste.
Die mit Abstand größten Verursacher von Abholzung durch EU-Importe waren dem Bericht zufolge Soja (rund 31 Prozent der gerodeten Fläche) und Palmöl (rund 24 Prozent), für deren Anbau oder Produktion vor allem Wälder in Südamerika beziehungsweise Südostasien weichen mussten. Dahinter folgten Rindfleisch, Holzprodukte, Kakao und Kaffee.
Schokolade zählt zu den beliebten Süßigkeiten. Sieben Millionen Tonnen davon werden jedes Jahr verzehrt. Doch hinter ihrer Herstellung verbirgt sich eine dunkle Seite. Beitragslänge: 42 min Datum: 18.09.2020
Deutschland in EU für die meisten Abholzungen verantwortlich
Unter den EU-Ländern ist Deutschland für die meiste Abholzung durch Importe verantwortlich: Im Schnitt wurden dafür pro Jahr 43.700 Hektar Wald gerodet – eine Fläche etwa halb so groß wie Berlin. Nach Einwohnern gerechnet liegt Deutschland allerdings in etwa im EU-Schnitt. Der meiste Wald pro Einwohner wurde für Importe in die Niederlande, nach Belgien und Dänemark gerodet.
Die Rodungen machen sich dem Bericht zufolge nicht nur in Ökosystemen weit weg von Europa bemerkbar, sondern betreffen auch das Weltklima. Durch die importierte Entwaldung habe die EU 2017 indirekt 116 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verursacht, heißt es in dem WWF-Bericht. Das entspreche mehr als einem Viertel der EU-Emissionen aus der Landwirtschaft im selben Jahr. Solche indirekten Emissionen würden in den Statistiken zu Treibhausgas-Emissionen nicht erfasst.
Video WWF-Report – Waldvernichtung im Sekundentakt
Das Ausmaß der weltweiten Zerstörung tropischer Regenwälder ist immens. An der Entwaldung für Acker- und Weideflächen tragen auch deutsche Verbraucher eine Mitschuld. Videolänge 1 min von Christine Elsner
EU hat Waldzerstörung jedoch reduziert
Der Bericht zeigt jedoch auch, dass die EU die durch Importe verursachte Waldzerstörung von 2005 bis 2017 um 40 Prozent reduziert hat. 2005 machte der EU-Anteil weltweit noch 31 Prozent aus, Europa lag bis 2013 auf Platz eins der “Weltrangliste der Waldzerstörer”, wie es der WWF in dem Bericht formuliert.
Selbstverpflichtungen von Unternehmen und Regierungen hätten in einigen Fällen zwar etwas gebracht. Erfolgreich seien sie letztlich aber nicht gewesen. Denn: Das erklärte EU-Ziel, die Entwaldung bis 2020 zu stoppen, wurde nicht erreicht. Der WWF fordert deshalb EU-Gesetze mit verbindlichen Regeln.
Entscheidend sei, dass es verbindliche Anforderungen an Unternehmen und den Finanzsektor gebe, fordert die Stiftung. Rohstoffe müssten zurückzuverfolgen, Lieferketten transparent sein.
Zentral sei außerdem, sich nicht etwa an den Regeln der exportierenden Länder zu orientieren – denn nach den Gesetzen vor Ort können die Rodungen durchaus legal sein.
Die Ära der Naturzerstörung muss enden, denn natürliche Ökosysteme wie Wälder sind unsere Lebensversicherung.
Christine Scholl, beim WWF zuständig für nachhaltige Lieferketten
Video
Sie kämpfen digital: drei mutige Frauen aus Ecuador. Mit Mikrofon und Rekorder im Regenwald. Ihr kleiner Radiosender wird zur Bastion gegen die Ausbeutung ihrer Heimat. Beitragslänge: 28 min Datum: 02.08.2020
Verantwortung nicht auf die Schultern der Konsumenten laden
Auf die Schultern der Konsumenten will der WWF die Aufgabe nicht geladen wissen, das Ausmaß der Rodungen zu reduzieren. Es solle vielmehr eine Selbstverständlichkeit sein, dass das, was auf den Tellern lande, nicht mit der Zerstörung des Planeten oder der Verletzung von Menschenrechten zusammenhänge, sagte Anke Schulmeister-Oldenhove vom WWF, die Hauptautorin des Berichts.
Darüber hinaus könne aber durchaus der eigene Konsum – etwa von Fleisch – und dessen Folgen hinterfragt werden. Quelle: dpa