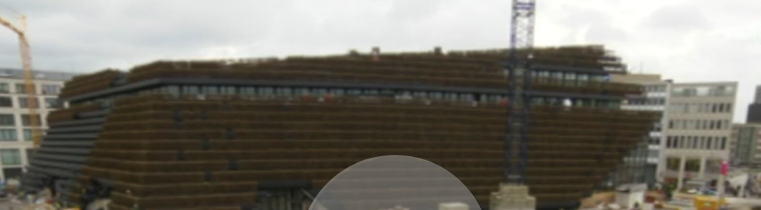Sehr geehrte Damen und Herren,
im Anhang senden wir Ihnen den 5. Offenen Klimanotstandsbericht des Bochumer Klimaschutzbündnisses – diesmal zum Wohnraummanagement – zu. Auf 11 Seiten werden Fragen zum Klimaschutz mit umfangreichen Hintergründen zum Klimaschutz beim Wohnungsbau gestellt. Eine akribische Auflistung von Informationen zur Situation in Bochum mit kritischen Fragen zu politischen Beschlüssen wie z. B. dem Wohnbaulandkonzept weisen eine sachkundige Auseinandersetzung mit dem Thema aus.
Wir bitten um Berichterstattung zu dem offenen Klimanotstandsbrief.
Für die Berichterstattung bedanken wir uns im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
für das Bochumer Klimaschutzbündnis (www.boklima.de)
(Sprecher von BoKlima) AkU e.V., Alsenstr.27, 44789 Bochum
Mailkontakt: boklima@boklima.de
Homepage: www.boklima.de
Kategorie: #-Status zur Sichtbarkeit
Ratsfraktion in Bochum beklagt Info-Mangel beim Klimaschutz
Kritik richtet die Fraktion „FDP & Stadtgestalter“ an die Verwaltung in Bochum: Sie informiere nicht genug über die Umsetzung von Klimaschutz.
Die Fraktion FDP & Die Stadtgestalter wirft der Stadt Bochum mangelnde Information zum Klimaschutz vor.
Bereits im März habe sie bei der Stadt um Infos zum Stand der Umsetzung der verschiedenen Klimaschutzkonzepte angefragt. „Eine gekündigte Antwort zur Ratssitzung am 25.06.2020 wird nun offensichtlichverschleppt“, erklärt Fraktionsvorsitzender Felix Haltt mit Blick auf die Tagesordnung.
Die Verwaltung müsse die Mitteilung „unbedingt nachreichen“. „Eigentlich wäre eine Beantwortung laut der Geschäftsordnung bereits im Mai fällig gewesen. Dann kündigte man an, die Antwort zur Ratssitzung am 25. Juni zu liefern. In der Tagesordnung der Sitzung fehlt die Mitteilung bislang jedoch.“
„Mit der Transparenz beim Klimaschutz hapert es in Bochum“
Fraktions-Vize Volker Steude: „In Bochum werden immer wieder schnell und vollmundig Versprechungen und Konzepte aufgestellt oder angekündigt. Bei der Umsetzung hapert es dann oft erheblich“, ergänzt mit Blick auf das „verschleppte Radverkehrskonzept“.
Haltt ergänzt: „Hier muss man dem Bochumer Klimabündnis schon recht geben, denn mit der Transparenz beim Klimaschutz hapert es in Bochum. Die Politik und die Öffentlichkeit brauchen eine Auskunft darüber, wie weit wir mit den CO2-Einsparungen sind und bei welchen Maßnahmen die Verwaltung Schwierigkeiten in der Umsetzung hat, damit man auch effektivgegensteuern kann.“
(Anmerkung der Redaktion BoKlima :
Lesen Sie hierzu auch den Brief des Bochumer Klimaschutzbündnisses zu einem Jahr Klimanotastand )
(Hinweis von Christian)
Mitteilung der Verwaltung Sachstand Klimaschutz in Bochum (08.06.2020)
Mitteilung der Verwaltung Vorlage Nr.: 20201325
Status: öffentlich
Datum: 08.06.2020
Verfasser/in: Dr. Nils Leber / Frank Frisch
Fachbereich: Dezernat VI
Bezeichnung der Vorlage: Sachstand Klimaschutz in Bochum
Beratungsfolge:
Gremien: Sitzungstermin: Zuständigkeit:
Haupt- und Finanzausschuss 17.06.2020 Kenntnisnahme
Rat 25.06.2020 Kenntnisnahme
Kurzübersicht:
Die Stadt Bochum betreibt bereits seit Jahren erfolgreich Klimaschutz und Klimaanpassung und ist damit auch im regionalen Vergleich sehr erfolgreich. So konnten die Treibhausgasemissionen in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich reduziert werden. Um diese Bemühungen zu unterstreichen hat der Rat der Stadt im Juni 2019 den Klimanotstand verkündet. Die Erklärung des Klimanotstandes ist der politische Auftrag, die erfolgreichen Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung weiter zu intensivieren. Die Verwaltung nimmt die Jährung des Ratsbeschlusses zum Klimanotstand zum Anlass, einen Sachstand zu den laufenden und den geplanten Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung zu geben.
Wortlaut:
Ausgangslage
Die Stadt Bochum ist bereits seit langen Jahren in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung aktiv. Mit Beitritt zum Klimabündnis („Alianza del Clima“) hat die Stadt die „Resolution des Klima-Bündnis‘“ inkl. der Selbstverpflichtung im Bereich CO 2 -Reduktion bereits im Jahr 1993 anerkannt und hat sich angelehnt an die nationalen und internationalen Klimaziele und auf der Grundlage der Erkenntnisse des ICPP seit dem ersten Klimaschutzkonzept (ifeu 2002) und den folgenden Energie- und Klimaschutzkonzepten (Bochum 2020 und Bochum 2030 konkrete Dekadenziele auf die Agenda geschrieben.
Den Klimaschutzkonzepten folgend wird bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgase (THG)um 65 % (zum Vergleich Nationaler Klimaschutzplan 2050: -55 % bis zum Jahr 2030). Für das Jahr 2050 sieht das aktuelle Klimaschutzkonzept der Stadt Bochum eine Reduzierung um -85% THG vor. Diese Ziele werden vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erneut zu überprüfen sein.
1Die Treibhausgas-Emissionen konnten in den zurückliegenden Jahren bereits merklich gesenkt werden. Die Verwaltung hat die CO 2 Bilanz in den letzten Jahren regelmäßig vorgestellt. Aktuelle Bilanzierungen erfolgen zukünftig durch den RVR (Pflichtaufgabe!). Sobald die Ergebnisse und Vergleiche vorliegen erfolgt eine gesonderte Mitteilung.
In seiner Sitzung am 6. Juni 2019 hat der Rat der Stadt Bochum die Resolution zur Ausrufung des Climate Emergency (Klimanotstand) beschlossen (Vorlage Nr. 20191696).
Am 6. Juni 2020 jährt sich nun der Beschluss zum Klimanotstand erstmalig. Die Verwaltung nimmt diesen Umstand zum Anlass für eine Darstellung der aktuellen und der geplanten Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung.
Laufende Konzepte und Maßnahmen
Die Aktivitäten und Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung sowie im Bereich der Klimabildung wurden im zurückliegenden Jahr durch die Verwaltung erfolgreich umgesetzt und weiterentwickelt. In diesem Rahmen konnten eine Vielzahl von Projekten und Maßnahmen fortgeführt, neu konzipiert und/oder initial angestoßen werden.
Die Aktivitäten sowie die Maßnahmen und Projekte stammen aus verschiedenen Ämtern der Stadt Bochum (Tiefbauamt, Umwelt und Grünflächenamt, Amt für Stadtplanung und Wohnen u. w. m) und den Beteiligungsgesellschaften (Stadtwerke, USB, VBW). Dies unterstreicht den Querschnittscharakter der Themen Klimaschutz und Klimaanpassung. Oftmals bilden allerdings in diesen Projekten der Klimaschutz und die Klimaanpassung nicht den fachlichen Schwerpunkt. Dies macht in vielen Fällen ein trennscharfes Monitoring und/oder ein monetäres Controlling z.B. im Sinne der Bezifferung klar abgegrenzter Kosten schwierig.
Es muss allerdings konstatiert werden, dass sich die laufende Corona-Krise auf die eine oder andere Aktivität, gerade im Kontakt mit den Bürgerinnen der Stadt Bochum bremsend ausgewirkt hat. Dies ist vor allem im Bereich der Umweltbildung festzustellen.
Die Stadt Bochum nimmt weiterhin am European Energy Award–Zertifizierungs-verfahren (eea) teil und stellt sich der externen Auditierung erneut im Jahr 2021. Auch für den Bereich Klimaanpassung wird sich die Stadt Bochum einem Zertifizierungsverfahren European Climate Adaptation Award (eca) stellen. Der Förderbescheid wird kurzfristig erwartet.
Die Verwaltung hat in den Sitzungen des Ausschusses für Strukturentwicklung vom 18.06.2019 und vom 26.09.2019 jeweils einen Bericht über den aktuellen Sachstand zum Klimaschutz in Bochum und zu den bis dato durchgeführten Maßnahmen des Klimaschutzes gegeben (Vorlage Nr. 20191910 und 20192664).
Die nachfolgende Liste zeigt eine Auswahl von Maßnahmen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und der Klimabildung, die im zurückliegenden Jahr erfolgreich weitergeführt wurden.
Klimaschutz und Klimaanpassung
- Beschluss zur Teilnahme am ECA Zertifizierungsverfahren, Beantragung der Förder abge- schlossen, Bewilligungsbescheid wird in Kürze erwartet
- Klimafonds Projekte 2020 (bei dem Aufruf für Förderprojekte 2020 lag der Schwerpunkt auf Machbarkeitsstudien und Maßnahmen die bis September 2020 abgeschlossen sind, um diese im Oktober 2020 abzurechnen).
- Projekte der Stadt Bochum aus dem Bereich Stadtentwässerung
- Aktive Teilnahme in der Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von Morgen
- Machbarkeitsstudie zur Abkopplung des Sportplatzes an der Gahlensche Straße und zur Ableitung des Regenwassers in den Präsidentenbach
- Machbarkeitsstudie für die Umsetzung eines wassersensiblen Entwässerungskonzepts für den Stadtgarten in Wattenscheid. Prüfung des Abkopplungspotenzials städtischer Flä- 2o o o o o o chen und der Möglichkeit zur Einleitung in den Stadtgartenteich sowie Prüfung, ob der ak- tuelle Teichüberlauf in den Mischwasserkanal durch einen Überlauf in einen Regenwas- serkanal ersetzt werden kann mit Anschluss an den Wattenscheider Bach.
- Planung der Regenwasserableitung vom Gelände der KiTa an der Küpperstraße in den Stadtparkteich.
- Umbau der Hattinger Straße zwischen Königsallee und Kulmer Str. mit Baumrigolen, Überflutungskaskade, Regenwasserrückhaltung und –behandlung. Bauleistungen sind Bestandteil des ersten Förderantrags, die bis Ende 2020 abgeschlossen werden können.
- Rückbau der befestigten Fläche im Bereich des ehemaligen Bolzplatzes im Siepen „In der Hose“ am Kuhlenkamp zur Verbesserung des Überflutungsschutzes (Rückbau der aktuell befestigten Fläche, Neumodellierung des Geländes, Umgestaltung der Ein- und Ausläufe zur geplanten Flutmulde).
- Realisierung einer Dachbegrünung für das Schulgebäude der Schule „An der Marbrücke“
- Projekte von Tochterunternehmen der Stadt Bochum und gewerblicher Antragsteller
- Abkopplung der Betriebshoffläche der Stadtwerke Bochum GmbH an der Darpestraße.
- Machbarkeitsstudie zur Abkopplung der Betriebshofflächen der Bogestra an der Hattinger Str.
- Realisierung einer Dachbegrünung an der Herzogstr. 75.
- Machbarkeitsstudie der befestigten Flächen des BG Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH. Anschluss an den neu zu bauenden RW-Kanal in der Hattinger Straße.
- Ggf. kleinere Maßnahmen im Kontext des Quartierentwicklungsprojekts „Bochum_Nach2“ an der Bärendorfer Straße. Öffentlichkeitsarbeit
- Teilnahme an der Earth Hour 2020 (03/2020)
- Mitarbeiterinformation “Ausszeit” (Energiesparen im Homeoffice) Energieberatung
- Beschluss Vertragsverlängerung Energieberatung der Verbraucherzentrale (AUSO 03/2020; Rat 04/2020) E-Mobilität
- Ausbau Ladeinfrastruktur
- Beschaffung E-Autos
- E-Busse Bogestra (20 E-Busse sind in der Beschaffung, erste Busse sollen dann im Sommer 2020 in Dienst gestellt werden, Einsatz zunächst nur auf der Line 354 in Bochum) Fuß- und Radverkehr
- Unterschiedliche Maßnahmen zur Herstellung, Sanierung und Aufwertung des Alltagsradwegesystems (z.B. Installation Wegweisung für Radfahrerinnen, Spatenstich Teilstücke RS 1, Installation Radfahrstreifen Alte Wittener Str.)
- Grün-Projekte
- StadtBaumKonzept im Rahmen der Bochum Strategie (2019:1,4 Mio. mit insgesamt 1.200
- Bäumen, 2020: ca. 1.100 Baumplanzungen, zzgl. 500 Obstbäume in 2019 und 2020)
Meta-Daten zum Dokument :
| Name: | 20201325 | ||
| Aktenzeichen: | VI/R (3366) / VI/KS (1413) | ||
| Art: | Mitteilung der Verwaltung | ||
| Datum: | 18.05.2020 | ||
| Betreff: | Sachstand Klimaschutz in Bochum |
Im RIS hier ; Vollständiges Dokument bei Bochum.de , hier
(Hinweis von Christian)
Mit Tiny Forests gegen Klimawandel-Folgen
WDR 5 Neugier genügt – Freifläche. 05.06.2020. 09:07 Min.. Verfügbar bis 05.06.2021. WDR 5.
Biodiversität statt Monokultur: Tiny Forests sind kleine Waldstücke, die in jedem großen Garten angelegt werden können. Sie sollen widerstandsfähig sein gegen die Folgen des Klimawandels. Carolin Weische berichtet darüber im Gespräch mit Anja Backhaus.
Audio Audio Download
 Audio starten, abbrechen mit Escape . 00:00:00 Audio starten, abbrechen mit Escape
Audio starten, abbrechen mit Escape . 00:00:00 Audio starten, abbrechen mit Escape
siehe auch beim WDR
Pop-Up-Radweg auf dem Südring in acht Minuten (Pressemitteilung)
Samstag, 6. Juni 2020: Die Radwende begeht den ersten Jahrestag der Ausrufung des Klimanotstands in Bochum mit der Demonstration des schnellen Auf- und Abbaus eines verkehrssicheren, kostengünstigen und ressourcenleichten Radwegs, einem so genannten Pop-Up-Radweg. Rund 250 Radfahrer*innen, darunter Familien mit Kindern, nutzen ihn begeistert.
Um 14 Uhr startete am Samstag bei schönstem Wetter auf dem Kurt-Schumacher-Platz am Eingang zur Einkaufszone die Demonstration des Radwende Bündnis. Die Radwende hatte in Coronazeiten nur 50 Personen angemeldet. Zur Auftaktkundgebung sollten sie auf abstandskorrekten Markierungen stehen. Etwa 250 Radfahrer*innen waren jedoch schließlich gekommen und konnten erfolgreich den zuvor schnell eingerichteten Pop-Up-Radweg geschickt werden.
Nur acht Minuten hatte die Einrichtung der etwa 500 Meter langen Radspur zwischen dem Kurt-Schumacher-Platz vor dem Hauptbahnhof bis zur Viktoriastraße gedauert. Radwende-Mitglieder hatten mit im Abstand von wenigen Metern aufgestellten professionellen rot-weißen Leitkegel zur Verkehrssicherung die zweispurige Straße in eine Auto- und eine Radspur geteilt – ein so genannter Pop-Up-Radweg entstand.
Die Polizei hatte dabei nicht viel zu tun, sie kontrollierte lediglich, ob die Sprühkreide, mit der die Aktivist*innen das Radweg-Symbol auf die Straße gesprüht hatten, nicht eventuell doch permanent sein könnte.
Mit Abstand und in mehreren Blöcken starteten die Radler*innen auf die leider nur sehr kurze Strecke. Anders als bei normalen Demos mussten sie sich auch an die Regeln der Straßenverkehrsordnung halten und stoppten an den Ampeln – schließlich waren sie auch ohne Polizeibegleitung im dichten Samstagsverkehr unterwegs.
Die Radwende wollte so zeigen, wie komfortabel und gewöhnlich ein Pop-Radweg sein kann. Auf diesem gelten natürlich auch die normalen Regeln des Straßenverkehrs, auch wenn er vom Autoverkehr deutlich getrennt ist. Bis auf den Entfall einer Fahrspur ergab der Aufbau auch für den Autoverkehr keine Probleme. Die Autofahrer*innen konnten in die und aus den einmündenden Straßen ein- und abbiegen, selbst die Bussfahrer*innen kamen ohne weiteres durch eine allerdings immer wieder zu öffnende Lücke in der Leitkegelreihe zum Halt an der großen Bushaltestelle vor der Kortumstraße. Mit einer entsprechenden Beschilderung, wie sie die Radwende an den Einmündungen und eingesetzt hatte, wäre auch dies ohne Aufwand möglich.
An der Kreuzung setzten die Teilnehmer auf die andere Seite des Südrings und fuhren zum Hauptbahnhof zurück – allerdings dort nicht geschützt durch eine Pop-Up-Spur. Den Unterschied konnten sie hautnah spüren, selbst wenn ihnen die Gruppen der vielen Radler*innen Sicherheit gab. Denn die durch die neue Straßenverkehrsordnung eigentlich bekannter gewordenen Abstandsregel von 1,50 Meter für das Überholen durch Autos erhöht das Sicherheitsgefühl nur, wenn ohne markierte Trennung auch die Geschwindigkeit der Überholenden reduziert ist und Autofahrer*innen aufmerksam sind.
Das war zumindest das Fazit vieler Teilnehmer*innen gegenüber den Radwende-Veranstalter*innen. Gerade Eltern mit Kindern spürten den Unterschied deutlich. „Der Pop-Up-Radweg erzeugt viel mehr Sicherheit bei mir und sichtbar auch bei meiner Tochter“, äußerte sich ein Vater. „Niemals würde ich mit meinem Kind auf dem Rad über den Ring fahren, ohne eine solche Sicherung oder wenn nicht mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind“, sagte eine Mutter.
„Steigt die Zahl der Radfahrer*innen auf den Straßen, steigt auch die Sicherheit für sie, das zeigt sich hier ganz deutlich“, sagte ein Mitradler. „In Städten, in denen mehr Radfahrer*innen unterwegs sind, oder wie jetzt auf dem Südring, wächst auch die Rücksicht der Autofahrer*innen.“
Auch andere Teilnehmer*innen berichteten, dass sie eigentlich keine bösen Worte von den überholenden Autofahrer*innen hören mussten. „Alle waren sehr freundlich und rücksichtsvoll“, meinte eine Radlerin, „obwohl der Ring offenbar auch wegen des kostenlosen Parkangebots sehr stark befahren war.“
Damit zeigte das zweite Experiment eines Pop-Up-Radwegs auf dem Ring wieder deutlich, wie schnell und kostengünstig mehr Radmobilität in der Stadt möglich wäre. Glaubt man den Berliner Erfahrungen, kostet die Einrichtung von Pop-Up-Radwegen etwa 50-mal weniger als permanente Straßenumbauten, von der Ökobilanz und den jahrelangen Planungszeiträumen ganz zu schweigen.
Dass sich mit einer Verbesserung der Radmobilität auch die stagnierende Klimabilanz der Stadt verbessern würde, war Thema des Redebeitrags der Auftaktkundgebung (siehe Anhang). Schließlich ist der der Verkehr mit einem CO2-Emissionsanteil von 37 Prozent der stärkste Klimatreiber. Mit der Erhöhung des Radverkehrsanteils von sieben auf 25 Prozent, wie ihn sich die Stadt seit 2016 als Mitglied der Arbeitsgemeinchaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) vorgenommen hat, wäre sicherlich eine entsprechende Reduktion sichtbar. Die Radwende bemängelt in der Rede deutlich, dass es überhaupt keine aktuellen Zahlen zu Klimanotstand und -bilanz in Bochum gibt.
„Ein Radverkehrskonzept, was bis heute erst sechs Jahre lang unbearbeitet blieb, jetzt nach dem Ratsbeschluss aber in zwei Jahren kommen soll, wird erst in einigen Jahren nach der Umsetzung Erfolge zeigen“, meinte Christoph Bast von der Radwende. „Mit Pop-Up-Radwegen und Tempo 30 ließe sich dagegen innerhalb kürzester Zeit und ohne ressourcenintensiven Straßenbau selbst in der Autostadt Bochum mehr Radmobilität erzeugen – und damit auch der Klimanotstand verbessern.“
Der Straßenumbau zum Auto-Südring erfolgte nach Ende der Demonstration sogar noch schneller. In sechs Minuten bauten nur wenige Aktive die Strecke zurück. „Wenn wir irgendwann die beiden innenliegenden Spuren des Rings zur Fahrradstraße machen wollen, brauchen wir mit den ressourcenleichten Pop-Up-Radwegen auch keine größeren Straßenumbauten. Das spart enorm viel an Energie und Baumaterial“, sind sich die Radwende-Aktivist*innen sicher.
Trotz des nur kleinen Radkreisels auf dem Südring zeigten sich die meisten Teilnehmer*innen begeistert: „Das machen wir jetzt jede Woche“, war häufiger zu hören.
Fotos zur freien Verwendung unter: https://www.radwende-bochum.de/2020/06/06/erste-fotos-radaktion-popup-radwege-fuer-bochum/
Redebeitrag: Pop-Up-Radwege für Bochum
Liebe Freundinnen und Freunde!
Heute ist der erste Jahrestag des Klimanotstands in Bochum. Krass, was in diesem einen Jahr passiert ist.
Klimaschutz ist jedenfalls DAS Thema in Bochum: Umweltfreundliches Bauen, Wärmewende, klimafreundliche Mobilität, Kinder, die sicher quer durch die Stadt radeln.
Wahnsinn, was alles geht, hier wo das WIR noch zählt!
Aber der Reihe nach:
Vor einem Jahr hatte der Rat der Stadt tatsächlich beschlossen, dass mit der Ausrufung des Notstands alle städtischen Entscheidungen unter „Klimavorbehalt“ gestellt werden. Zumindest haben wir das damals so verstanden.
Schließlich steht in der Resolution vom 6. Juni 2019:
„Die Kommune erklärt den Climate Emergency und anerkennt damit die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe höchster Priorität.“
Super. Eine tolle Anerkennung der Realität und der damals schon über ein halbes Jahr andauernden Proteste von Fridays-for-Future – die übrigens Teil des Bündnis Radwende sind.
Jeden Freitag hatten sie demonstriert, bei Wind und Wetter. Sie waren nicht zu übersehen, sie nervten, waren jung – und fanden breite Unterstützung.
SPD und Grüne erklärten in Bochum den Notstand. Den Klimanotstand. Auf der Basis von zwei Bürgeranträgen nach Paragraph 24 der Gemeindeordnung.
Nicht zu fassen: Demokratie! Bürgerbeteiligung! Endlich lokal die menschengemachte Erderwärmung bekämpfen, die lokale Verantwortung für das begrenzte noch zu emittierende CO2-Budget anerkennen, der Rat, die Verwaltung, alle machen mit.
Denn:
„Die Kommune wird die Auswirkungen auf das Klima sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit bei jeglichen davon betroffenen Entscheidungen berücksichtigen und wenn immer möglich jene Entscheidungen prioritär behandeln, welche den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen.“
vollständiger Artikel hier bei der Radwende, Redebeitrag
Bilder auch beim AKU
Auch auf Bo-Alternativ
Bilder der Pop-up-Radweg-Aktion auf dem Südring
Ein Jahr Verkündung des Klimanotstands in Bochum:
Alles muss man selber machen: z. B. Pop-up-Radwege
1 Jahr Klimanotstand – andere Städte
Konstanz – Ein Jahr Klimanotstand: Was bringt es?
ZDF :
Klimanotstand – vor einem Jahr rief die Stadt Konstanz als erste Stadt in Deutschland diesen aus. Mehr als 60 weitere Städte sind gefolgt. Was hat es gebracht?
Sie waren die Ersten: vor einem Jahr rief Konstanz den Klimanotstand aus. Eine symbolische Aktion, aber mit dem Versprechen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Mehr als 60 Städte und Gemeinden sind dem Beispiel gefolgt. Aber hat was was gebracht?
Quelle und Video (ZDF) , 02.05.2020 14:00 Uhr : https://www.zdf.de/nachrichten/video/politik-klima-klimanotstand-100.html
Ein Jahr Klimanotstand in Konstanz: Symbolpolitik oder echter Wandel?
Daniela Becker , Journalistin, München
Der St.-Stephansplatz liegt mitten in Konstanz. Freitags und dienstags findet dort ein Wochenmarkt statt, an den anderen Tagen ist der Platz üblicherweise vollgeparkt. Vielfach durch Autos mit Schweizer Kennzeichnen, die gern zum Shoppen in das schöne Städtchen am Bodensee kommen. Doch im Moment wirkt der Platz öde: Infolge der Corona-Krise dürfen die Schweizer die Grenze nicht mehr passieren.
Die Ödnis schmerzt den städtischen Klimaschutzkoordinator Lorenz Heublein: Am langen Wochenende um den 1. Mai hätten auf dem St.- Stephansplatz Klimaaktionstage stattfinden sollen, genau ein Jahr nachdem die Stadt als erste deutsche Gemeinde den sogenannten “Klimanotstand” ausgerufen hat. Im Anschluss war geplant, die Fläche nicht wieder vollständig als Parkplatz zu nutzen – sondern fortan als “Stadtwandelaktionsfläche”, wo den Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten zum Klimaschutz aufgezeigt werden. “So wollten wir den ‚Notstand’ in eine aktivierende Mitmachphase überführen”, sagt Heublein. “Wir möchten die Stadtgesellschaft einladen, sich zu beteiligen, weil die Stadtverwaltung nur einen Teil zum Klimaschutz beitragen kann.”
Jannis Krüßmann (rechts) und Cyra Mehrer von #FridaysForFuture ist es noch längst nicht genug, was die Stadt Konstanz fürs Klima unternimmt;
Über das Wort ‚Notstand’ war auch in Konstanz lange diskutiert worden. Viele fanden die begriffliche Nähe zu den Notstandsgesetzen unangemessen. “Natürlich macht der Begriff vielen Menschen auch Angst. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise sieht man, dass der Klimawandel insgesamt immer noch eher als etwas sehr Abstraktes ist und weniger als Gefahr wahrgenommen wird. Nur wenn der Handlungsbedarf klar kommuniziert wird, wird auch etwas passieren”, meint Heublein.
So schienen es schließlich auch alle Parteien des Konstanzer Stadtrats zu sehen. “Der Klimanotstand beinhaltet die Aufforderung, diese Gefahren durch schnelles Handeln abzumildern oder zu beseitigen”, heißt es in dem Beschluss vom 2. Mai 2019, der einstimmig gefasst wurde, also mit den Stimmen aller Fraktionen. #FridaysForFuture ist mit dem bisherigen Ergebnis nicht zufrieden
Schnelles Handeln kann Jannis Krüßmann nicht wirklich erkennen. Der 18-Jährige ist einer der Vertreter von #FridaysForFuture in Konstanz, die die Klimaresolution ausgearbeitet hatten. “Wir dachten, mit dem Begriff ‘Notstand’ wird die Dramatik der Lage klar – und dass die Fraktionen selbst aktiv Klimaschutzmaßnahmen in den Gemeinderat einbringen”, sagt Krüßmann. “Das hat definitiv nicht in dem Ausmaß stattgefunden, wie wir uns das erhofft hatten.”
Zwar wurde innerhalb der Verwaltung direkt nach Beschluss des Notstands eine “Task Force Klimaschutz” eingerichtet, die Maßnahmen erarbeitete. “Wir wollten, dass alle Bereiche die Gelegenheit erhalten, ihre Ideen einzubringen, anstatt ihnen einfach etwas aufzuoktroyieren”, sagt Klimaschutzkoordinator Heublein. Heraus kam ein buntes Sammelsurium an Vorschlägen: vom Ausbau des kommunalen Energiemanagements über einen zentralisierten städtischen Fuhrpark und den Ausbau von Geh- und Radwegen bis hin zum Aufbau eines Klimabürgerrats, der die Verwaltung beraten soll. Daneben sollte eine Kommunikationsoffensive gestartet werden, um die Konstanzer Bürger*innen beim Klimaschutz stärker einzubeziehen.
Auch Gebäudesanierungen spielen eine Rolle: So hat sich die Stadt bei der Deutschen Energieagentur (dena) erfolgreich als Modellkommune für Energiespar-Contracting beworben. Die Gemeinde erhält dadurch nun einen kostenlosen Berater an die Seite gestellt, der sich eine kosteneffiziente Strategie überlegt, um in Zusammenarbeit mit Rundum-Dienstleistern ausgewählte Gebäude energetisch zu modernisieren. Immerhin: Der Stadtrat muss jetzt jeden Beschluss auf Klimafolgen prüfen
Eine weitere Maßnahme sind die so genannten “Klimarelevanzprüfungen”. Die Gemeinderäte müssen nun bei jeder Beschlussvorlage per Kästchenabfrage beantworten, ob mit dem Beschluss eine positive, negative oder gar keine Auswirkungen für den Klimaschutz zu erwarten sind. Wird “negativ” ankreuzt, was im Grunde bei nahezu allen Beschlüssen zur Stadtentwicklung und Infrastruktur der Fall ist, muss die eigentliche Begründung zur Vorlage darauf eingehen, wie diese negativen Auswirkungen konkret aussehen – und was man unternommen hat, um diese möglichst gering zu halten.
…
Quelle : torial.com : https://www.torial.com/daniela.becker/portfolio/490616 ,
und Klimafakten.de : https://www.klimafakten.de/meldung/ein-jahr-klimanotstand-konstanz-symbolpolitik-oder-echter-wandel
Erlangen
Am 29. Mai 2019 wurde in der Universitätsstadt Erlangen der Klimanotstand ausgerufen. Zeit für eine Zwischenbilanz.
1 Jahr Klimanotstand, Zwischenbilanz (Video via Youtube ) : https://www.youtube.com/watch?v=VwVldPfWfLo
Kiel
Praxisbeispiel: Kiel im Klimanotstand | Meine Kommune im Klimanotstand
Deusche Bundesstiftung Umwel
Viedeo :
Durch die Warnungen der Klimawissenschaftler*innen, die Extremwetterereignisse der letzten Jahre und nicht zuletzt durch Aktivitäten von Fridays For Future ist der Klimaschutz ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt. Die aktuell unverändert ansteigenden Treibhausgasemissionen verlangen nach raschen, ambitionierten Zielsetzungen und umfassenden Handlungen auf allen staatlichen Ebenen. Eine besondere Rolle kommt hier den Städten, Gemeinden und Kreisen zu. Mit ihrer Planungshoheit für Gebäude und im Verkehrsbereich entscheiden die Kommunen heute maßgeblich über die Treibhausgasbelastung der Atmosphäre in der Zukunft. Dank ihrer Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern können hier positive Impulse für Klimaschutz in der Kommune gesetzt werden.
Referentin:
Anna Muche, Klimaschutzmanagerin Stadt Kiel https://www.kiel.de/
Playlist mit allen Videos der Veranstaltung: https://www.youtube.com/playlist?list…
Bildergalerie: https://www.flickr.com/photos/d_b_u/a… ________________________________________
Veranstaltet durch:
Klima-Bündnis: https://www.klimabuendnis.org
Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen: https://www.klimaschutz-niedersachsen…
EnergieAgentur.NRW: https://www.energieagentur.nrw/
LandesEnergieAgentur Hessen: https://www.landesenergieagentur-hess…
Deutsche Bundesstiftung Umwelt: https://www.dbu.de/
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) https://www.dbu.de/
Veranstaltung : Meine Kommune im Klimanotstand – Was nun
Zusammenfassung der Veranstaltung | Meine Kommune im Klimanotstand – Was nun , 29.01.2020 DBU , Zentrum für Umwelt
Video : https://www.youtube.com/watch?v=M_9q5wu4ZGY
Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU
Durch die Warnungen der Klimawissenschaftler*innen, die Extremwetterereignisse der letzten Jahre und nicht zuletzt durch Aktivitäten von Fridays For Future ist der Klimaschutz ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt. Die aktuell unverändert ansteigenden Treibhausgasemissionen verlangen nach raschen, ambitionierten Zielsetzungen und umfassenden Handlungen auf allen staatlichen Ebenen. Eine besondere Rolle kommt hier den Städten, Gemeinden und Kreisen zu. Mit ihrer Planungshoheit für Gebäude und im Verkehrsbereich entscheiden die Kommunen heute maßgeblich über die Treibhausgasbelastung der Atmosphäre in der Zukunft. Dank ihrer Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern können hier positive Impulse für Klimaschutz in der Kommune gesetzt werden.
Statements von:
- Alexander Bonde, DBU-Generalsekretär
- • Prof. Dr. Markus Große Ophoff, DBU Zentrum für Umweltkommunikation
- • Anna Muche, Klimaschutzmanagerin Stadt Kiel
- • Cornelia Rösler, Deutsches Institut für Urbanistik
- • Dr. Dag Schulze, Klima-Bündnis
- • Dr. Karsten McGovern, LandesEnergieAgentur Hessen
- • Josephine Dai, Fridays For Future Osnabrück
- • Cord Hoppenbrock, Klimaschutzmanager Landkreis Osnabrück
- • Marcus Müller, Stadt Lüdenscheid
- • Heinrich Strößenreuther, GermanZero
- • Sarah Göttlicher, WertSicht
- • Isa Reher, Kreis Stormarn
- Gesamte Veranstaltung: https://www.youtube.com/playlist?list…
- Bildergalerie: https://www.flickr.com/photos/d_b_u/a… ________________________________________
- Veranstaltet durch:
- Klima-Bündnis: https://www.klimabuendnis.org
- Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen: https://www.klimaschutz-niedersachsen…
- EnergieAgentur.NRW: https://www.energieagentur.nrw/
- LandesEnergieAgentur Hessen: https://www.landesenergieagentur-hess…
- Deutsche Bundesstiftung Umwelt: https://www.dbu.de/ ________________________________________ ________________________________________
- Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) https://www.dbu.de/
- Twitter: https://twitter.com/umweltstiftung
Kostenloser öffentlicher Nahverkehr – Pro und Contra
NIEDERANVEN 11.05.2020
Wie kann der städtische Verkehr entlastet werden? Einige Städte versuchen es mit einem kostenlosen ÖPNV-Angebot, ohne Kritik bleiben diese Maßnahmen jedoch nicht. Ist der Gratis Nahverkehr wirklich die Lösung für den Verkehrskollaps?
Alte Idee, neue Diskussionen
Die Nutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel kostenlos anzubieten, ist keineswegs eine neue Idee. Hans Bass von der Hochschule Bremen etwa zeigt auf, dass das Konzept bereits seit den 1970er Jahren thematisiert wurde – unter anderem im Ruhrpott. Die Dortmunder Fahrpreisunruhen von 1971 nahmen dabei wenigstens zwei Aspekte vorweg, die bei heutigen Diskussionen um einen unentgeltlichen Nahverkehr eine Rolle spielen, wenn auch unter veränderten Vorzeichen:
- Die Frage nach dem „gerechten Preis“, die sich bei einem kostenlosen ÖPNV-Angebot eben nicht automatisch erledigt. Im Gegenteil – es geht darum, wie ein solches Angebot (gerecht) finanziert werden soll, damit es für die Nutzer überhaupt gratis sein kann.
- Die Frage nach möglichen Lösungen für Mobilitätsprobleme, insbesondere in der Stadt – und das vor dem Hintergrund der ökologischen Auswirkungen des Stadtverkehrs.
Die Stadt Dortmund im Jahr 1971 weist mit Blick auf die heutige Problematik gleichermaßen Parallelen wie Unterschiede auf. Obwohl zum Zeitpunkt der Unruhen die Wirtschaftswunderjahre vorläufig noch anhielten, war die Wohlstandsgesellschaft noch längst nicht so weit, dass ein eigenes Auto selbstverständlich gewesen wäre.
Nahverkehrsmittel stellten damals also für viel mehr Menschen eine Notwendigkeit dar und das noch aus einem weiteren Grund: Die städtischen Strukturen waren bereits so ausgebildet, wie es auch heute noch der Fall ist. Das heißt, die einzelnen Lebensbereiche – Wohnen, Arbeit, Einkaufen – waren bereits räumlich voneinander getrennt.
Heute wird diese Trennung vorwiegend mit dem eigenen Auto überwunden, das Verkehrsaufkommen ist entsprechend hoch. Innovative Verkehrskonzepte können zwar ihren Teil dazu beitragen, die innerstädtischen Zustände zu entschärfen. Doch begleitende Maßnahmen scheinen sinnvoll, um langfristige Lösungen zu schaffen.
Eine dieser Lösungen steht seit einigen Jahren wieder verstärkt im Fokus – der kostenlose öffentliche Personennahverkehr. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang jedoch weiterhin stellt: Kann dieses Konzept die gestellten Erwartungen tatsächlich erfüllen?
Pro: Kostenlos, solidarisch, nachhaltig
Selbst in Großstädten, die über ein breit gestreutes ÖPNV-Angebot verfügen, bleiben Autos meist die erste Wahl. Sie sind bequem und gewähren eine Unabhängigkeit, die Bus und Bahn in dieser Form nicht gewährleisten können. Spätestens zu den Hauptverkehrszeiten erweist sich das aber als Nachteil: Ein hohes Aufkommen an Individualverkehr macht ein zügiges Vorankommen schwierig.
Verkehrsverlagerung und Folgeeffekte
Die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel kann deshalb ein Anreiz für einen sogenannten Verkehrsverlagerungseffekt sein: Mehr Menschen wechseln vom motorisierten Individualverkehr zum ÖPNV, die Fahrgastzahlen steigen entsprechend.
Dieser Effekt wirkt sich wiederum in unterschiedlicher Weise aus:
- Weniger motorisierte Fahrzeuge auf den Straßen bedeuten nicht nur einen besseren Verkehrsfluss. Es entstehen außerdem Räume für andere Verkehrsmittel, wie Fahrräder.
- Vom insgesamt geringeren Verkehrsaufkommen profitieren letztendlich alle Verkehrsteilnehmer: Höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten bedeuten kürzere Fahrzeiten bis zum Ziel. Dadurch könnten sogar die Betriebskosten des ÖPNV reduziert werden – das hängt jedoch davon ab, wie sich das Nutzungsverhalten verändert: Steigende Fahrgastzahlen relativieren womöglich die Einsparungen durch niedrigere Umlaufzeiten.
- Für Radfahrer wie für Fußgänger besteht außerdem ein geringeres Unfallrisiko – diese neue Sicherheit kann ein weiterer Treiber sein, um alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zu nutzen. Gleichzeitig senken geringere Unfallzahlen die Kosten.
Überhaupt sind die Kosten ein wichtiger Faktor. Wenn die Ausgaben für den Unterhalt eines Autos wegfallen und die Alternative kostenlos genutzt werden kann, entlastet das die Haushalte finanziell.
Soziale Mobilität
In der Soziologie ist mit sozialer Mobilität zwar – verkürzt zusammengefasst – die Möglichkeit des gesellschaftlichen Auf- und Abstiegs gemeint, etwa durch berufliche Veränderungen. Im Zusammenhang mit einem kostenfreien ÖPNV könnte der Mobilitätsaspekt jedoch in einem weniger übertragenen Sinne verstanden werden.
Lena Frommeyer, Journalistin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), rückt den Solidaritätsgedanken in den Vordergrund. Sie argumentiert mit den steigenden Kosten, die in den wachsenden Städten für die Bewohner entstehen: Höhere Mieten einerseits, höhere Ticketpreise andererseits, um aus den günstigeren Stadtrandgebieten in die Zentren zu gelangen.
Im Grunde genommen ist die Gemengelage dadurch wieder ähnlich wie im Dortmund des Jahres 1971, der „gerechte“ Preis bewegt sich nur inzwischen in anderen Dimensionen. Mit kostenlosen Tickets gibt es zumindest im Hinblick auf die Mobilität des Einzelnen weniger soziale Ungleichheit.
Nachhaltige Lösung
Gleichzeitig lässt sich mit der Verkehrsverlagerung zu Gunsten des ÖPNV ein weiteres dringliches Problem der Städte angehen: Umweltbelastungen. Motorisierter Verkehr in den Innenstädten trägt erheblich zur schlechten Luftqualität bei.
Die Bilanz öffentlicher Verkehrsmittel ist in dieser Hinsicht deutlich besser, was sich schon durch das Verhältnis von Fahrzeug zu transportierten Personen erklärt. Dennoch kann der ÖPNV nur ein Teil der Gesamtlösung sein, um in den Städten für sauberere Luft zu sorgen. Eine wirkungsvolle Verkehrswende kann aber nur gelingen, wenn alle verfügbaren Maßnahmen ergriffen werden – und der kostenlose ÖPNV kann eine davon sein.
Contra: Teuer und ohne Erfolgsgarantie
Was die Versuche mit dem kostenlosen ÖPNV in vielen Städten bislang, bei allen Vorzügen des Konzepts, gezeigt haben: Das Gratis-Angebot ist noch keine Garantie für eine erfolgreiche Trendwende. Dass sich die optimistische Erwartungshaltung in der praktischen Umsetzung häufig nicht erfüllt, hat ganz unterschiedliche Gründe.
Selbst, wenn die Fahrgastzahlen nicht die einzige Bemessungsgrundlage für Erfolg oder Misserfolg des kostenlosen Nahverkehrsangebots sind, zeigt das Konzept auch Schwächen.
Wenige neue Nutzer im ÖPNV
Tatsächlich zeigt sich der Verlagerungseffekt bei den Fahrgastzahlen von Stadt zu Stadt in recht unterschiedlichem Ausmaß. Oft liegt der Anteil neuer ÖPNV-Fahrgäste unter dem, was als erheblich betrachtet werden kann: In der estnischen Hauptstadt Tallinn beispielsweise können alle Einwohner Bus und Bahn kostenlos nutzen, schon seit 2013. Gestiegen sind die Fahrgastzahlen seither um 14 Prozent, ein vergleichsweise geringer Wert.
Allerdings waren die Ticket-Preise für weite Teile der Bevölkerung schon vor der Einführung des kostenlosen ÖPNV recht niedrig. So sind es vor allem Erwerbslose und Niedriglohnarbeiter, welche die Möglichkeit für mehr Mobilität bekommen – und nutzen.
Kaum Verkehrsverlagerung
Dieser Effekt ist sicherlich als Erfolg zu werten, er zeigt aber keineswegs eine breite Verkehrsverlagerung, die Befürworter des kostenlosen Nahverkehrs als eines der Hauptziele ausgeben. Womit gleichzeitig das Nachhaltigkeitsziel nicht erreicht werden kann, nämlich die Verringerung von Schadstoffen aus dem motorisierten Individualverkehr.
Kostenlose Tickets allein erweisen sich für viele Autofahrer als zu geringer Anreiz. Meist fällt die Entscheidung wegen der größeren Entscheidungsfreiheit, der höheren Flexibilität und des besseren Komforts immer noch für das eigene Auto.
Soll das Fahrzeugaufkommen im städtischen Verkehr also spürbar reduziert werden, sind dazu in der Regel flankierende Maßnahmen notwendig. Im belgischen Hasselt etwa wurde parallel die Infrastruktur der Stadt weitflächig umgestaltet:
- Die Anzahl der verfügbaren Parkplätze in der Stadt wurde reduziert.
- Parken war zudem nur noch kostenpflichtig möglich.
- Innerhalb der gesamten Stadt wurden Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen eingeführt.
Auf der einen Seite muss der motorisierte Individualverkehr unattraktiver werden, damit der Umstieg auf den ÖPNV attraktiver wird. Unter solchen Voraussetzungen greift auch der Preisanreiz besser.
Kostenlos bedeutet nicht ohne Kosten
Diese Voraussetzungen müssen allerdings erst geschaffen werden und das verursacht wiederum Kosten. Denn kostenlose Nahverkehrsangebote benötigen für ihre Verwirklichung Investitionen in unterschiedlichen Bereichen. Die Veränderungen bei der Infrastruktur sind nur ein Aspekt, dazu muss außerdem das Angebot der Verkehrsverbände ausgebaut werden: Mehr Haltestellen, eine engere Taktung, ein ausgedehnteres Liniennetz – all das ist zunächst mit Kosten verbunden.
Auf der anderen Seite fallen dagegen die Erlöse aus den Fahrentgelten weg, kostendeckendes Wirtschaften wird für die kommunalen Betriebe zum Problem. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, wie die Verkehrsunternehmen ihre Kapazitäten planen müssen:
- Die Kapazität orientiert sich am Spitzenbedarf, den es zu decken gilt.
- Der Spitzenbedarf hängt mit den Hauptverkehrszeiten zusammen und könnte sich noch steigern, sollten mehr Verkehrsteilnehmer zu diesen Zeiten Bus oder Bahn nutzen.
Ein höheres Fahrgastaufkommen bedeutet vielfach die Notwendigkeit, zusätzliche und gegebenenfalls größere Fahrzeuge anzuschaffen. Die Frage, die sich die Kommunen daher stellen müssen: Sind Kapazitätserweiterungen und Veränderungen der Infrastruktur langfristig finanzierbar?
In vielen Fällen lautet die Antwort nein, weil die notwendigen Mittel nicht aufgebracht werden konnten. Soll der kostenlose ÖPNV funktionieren, müssen nachhaltige Finanzierungsmethoden gefunden werden, um die Kosten für Unterhalt und notwendige Sanierungsmaßnahmen stemmen zu können.
Kostenloser öffentlicher Nahverkehr – eine Frage der Umsetzung
Das Konzept, das Angebot der Verkehrsbetriebe kostenlos zu machen, hat in vielerlei Hinsicht seinen Reiz. Das zeigt sich schon daran, dass sich immer wieder Städte an dieser Aufgabe versuchen, im Inland wie im Ausland.
Erfolg verspricht die Idee aber nur dann, wenn die notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen werden. Diese sind nicht nur weitreichend, sondern auch von Stadt zu Stadt verschieden.
Das bedeutet unter anderem, dass jede Stadt unterschiedlich gute Grundbedingungen mitbringt, um den ÖPNV umzugestalten. Kleine und mittelgroße Städte haben gegenüber Großstädten in dieser Hinsicht gewisse Vorteile: Geringere Einwohnerzahlen und ein besser überschaubares Liniennetz machen Anpassungen leichter kalkulierbar.
Dennoch muss die Umsetzung an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden, das gilt besonders bei den Möglichkeiten, das Konzept zu finanzieren. Letztendlich muss jede Kommune ihren eigenen Weg finden, um den kostenlosen ÖPNV sinnvoll in die Infrastruktur zu integrieren.
Selbst, wenn all das gelingt, bleibt am Ende immer noch die Frage, ob die Idee ausreichend Unterstützung findet. Damit sind nicht allein die potenziellen neuen Fahrgäste gemeint, die nun auf das Auto verzichten. Sondern vor allem auch die politischen Entscheider, die das Konzept mittragen müssen – nicht zuletzt unter Berücksichtigung der möglichen Effekte, die eine derartige Veränderung in anderen Lebensbereichen verursachen kann.
Quellen:
- Bass, Hans-Heinrich: Verkehrspolitik unter dem Druck der Straße, in: Werkstatt Geschichte, Nr. 61, 2013.
- https://www.researchgate.net/publication/256505958_Verkehrspolitik_unter_dem_Druck_der_Strasse_Die_Dortmunder_Fahrpreisunruhen_von_1971
- Bleier, Ulrike Anna/Hein, Theresa: Sollen Öffis für alle kostenlos sein?
- https://www.fluter.de/sollen-oeffis-fuer-alle-kostenlos-sein
- Groß, Helge/Valerius, Alexander: Kostenloser Nahverkehr – Ein Ausweg aus der Autostadt?
- https://www.robinwood.de/sites/default/files/130-22-23-verk-oepnv-free-neu.pdf
- Randelhoff, Martin: Welche Vor- und Nachteile hat ein kostenloser ÖPNV? Werden Autofahrer wirklich zur ÖPNV-Nutzung animiert?
- https://www.zukunft-mobilitaet.net/9011/analyse/kostenloser-oepnv-vorteile-nachteile-effekte/
- Spiegel Mobilität: Kostenloser Nahverkehr. Tickets bezahlen oder gratis fahren – welchem Modell gehört die Zukunft?
- https://www.spiegel.de/auto/deutschland-tickets-bezahlen-oder-gratis-fahren-welchem-nahverkehrs-modell-gehoert-die-zukunft-a-58879cd9-ba1c-4d41-b8a1-c901f5f52eb2
Beispiele
- Randelhoff, Martin: Unentgeltliche Nutzung des Nahverkehrs in Tallinn ab 2013 – ein Modell für andere Städte?
- https://www.zukunft-mobilitaet.net/8923/analyse/kostenloser-oepnv-tallinn-hasselt-templin-luebben/
- Ders.: Dünkirchen. Kostenfreie Nutzung des ÖPNV als Bestandteil einer umfassenden ÖPNV-Strategie.
- https://www.zukunft-mobilitaet.net/171194/analyse/duenkirchen-oepnv-kostenlos-kostenfreiheit-fahrscheinfrei-dunkerque-busverkehr-foerderung/
- Schulz, Benedikt: Kostenloser ÖPNV – und die Stadt verdient daran.
- https://www.zeit.de/mobilitaet/2018-02/kostenloser-nahverkehr-oepnv-tallinn-estland
- Tagesschau: Kostenloser ÖPNV. Luxemburg probt die Verkehrswende.
- https://www.tagesschau.de/ausland/luxemburg-oepnv-101.html
- ZDF: Monheim und Pfaffenhofen. Was bringen kostenlose Busse? Diese Städte testen es.
- https://www.zdf.de/nachrichten/heute/gratis-bus-fahren-monheim-und-pfaffenhofen-probieren-es-aus-100.html
Quelle : https://abes-online.com/publikationen/fachbeitrag/kostenloser-oeffentlicher-nahverkehr/
Macht die Städte grün – Konzepte für die Stadtbegrünung (WDR audio Feature)
Konzepte für die Stadtbegrünung (WDR audio Feature)
Dok 5 – Das Feature. 07.06.2020. 52:59 Min.. Verfügbar bis 05.06.2021. WDR 5.
Eine begrünte Garage, ein Parkhaus mit Fassadenbepflanzung, ökologischer Wohnungsbau – mehr Grün in der Stadt ist mehr als nur schön. Es ist eine Investition in die Zukunft. // Von Heike Sicconi / WDR 2020 / www.radiofeature.de
Der Klimawandel macht unsere Städte heißer, Starkregen überfordert städtisches Abwassermanagement. Das ist teuer und ungesund: Neurologen gehen sogar von einem Zusammenhang zwischen fehlendem Grün und der Volkskrankheit Depression aus. Gleichzeitig ist der Drang in die Städte ungebrochen. Weltweit, in Europa und auch in den Städten in NRW. Vielerorts werden neue Wege erprobt, wird auch investiert. Wie die Gratwanderung zwischen Verdichtung und grüner Infrastruktur gelingen könnte, darüber wird u.a. in einem Forschungsprojekt iResilience in Dortmund und Köln nachgedacht. Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmen wollen gemeinsam neue Lösungen, Technologien und Förderprogramme erarbeiten.
Die Stadtbegrünung an Fassadenbepflanzung oder ökologischer Wohnungsbau verschönert nicht nur das Stadtbild, sondern ist eine Investition in die Zukunft für mehr Lebensqualität.Jetzt anhörenAufnehmen
Die Umwelteinflüsse durch den Klimawandel lässt die Städte aufheizen und das städtische Abwassersystem mit Starkregen überfordern. Die Klimafolgen belasten das Finanzkapital der Städte und beeinflussen zusätzlich die Gesundheit der Menschen.
Denn Neurologen gehen von einer gegenseitigen Beeinflussung der fehlenden Pflanzen und der Volkserkrankung Depression aus. Und die Landflucht ist immer noch unaufhaltsam.
Aus diesem Grund werden neue Innovationen gesucht, die die Ballung der Städte mit grüner Infrastruktur ausgleichen. In dieser Hinsicht wurde das Forschungsprojekt iResilience in Dortmund und Köln ins Leben gerufen, um gemeinsam mit der Bevölkerung, den Kommunen und Unternehmen neue Lösungswege, Technologien und Förderprogramme zu erarbeiten.
zum Audio (03Min) : Ankündigung / Zusammenfassung :
zum Audio (53Min) : https://www1.wdr.de/mediathek/audio/feature-depot/index.html#
Die lebenswerte Stadt des 21. Jahrhunderts
Die Urbanisierung ist einer der bestimmenden Trends unserer Zeit. Denn die Städte wachsen und mit ihnen die Herausforderungen, die urbane Umwelt lebenswert zu gestalten. Wie kann es gelingen, die infrastrukturellen, ökologischen, ökonomischen und sozialen Probleme zu lösen, die sich durch die fortschreitende Verstädterung ergeben? Wie können Lebensqualität und Nachhaltigkeit in einer Umgebung gewährleistet werden, in der sich alles in zunehmendem Maße verdichtet?
Die neuen Städte für das 21. Jahrhundert sind unter diesen Voraussetzungen geprägt von einem steten Wandel, in dem innovative Technologien und neue Denkweisen notwendige Mittel sind. Anpassung und Optimierung sind die zentralen Säulen, um die sich die Entwicklung der Städte drehen wird, in allen Belangen.
Das vorliegende Meta-Dossier greift einige der Handlungsfelder und Aspekte auf, die bei der Transformation hin zu einer zukunftsfähigen und lebenswerten Stadt von elementarer Bedeutung sind. Es zeigt die unterschiedlichen Problemlagen, vielfältigen Zusammenhänge und möglichen Lösungsansätze auf, die die Städte und die Vorstellung von Stadtleben prägen – und prägen werden.
„Raum von Menschen, Raum für Menschen“ knüpft die Herausforderungen der Urbanisierung an stadtplanerische Lösungswege. Diese entstehen immer im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen, genauso wie sie stets ein Ausdruck der Möglichkeiten ihrer jeweiligen Zeit sind. Gleichzeitig lassen sich Ideen von der Antike bis in die heutige Zeit ausmachen, wenn auch im jeweiligen zeitlichen Kontext umgedeutet.
Der Schweizer Lucius Burckhardt, Begründer der Spaziergangswissenschaft, hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass Stadtplanung aber dann nur gelingen kann, wenn sie die vielschichtigen sozialen Verflechtungen berücksichtigt, die das Stadtleben letztendlich ausmachen, und neue Denkweisen wagt.
„Urbane Infrastruktur nachhaltig gestalten“ geht im Anschluss daran auf die vielfältigen Handlungsfelder ein, die sich im Zuge der Urbanisierung für die öffentliche Infrastruktur der Städte ergeben. Die notwendige Umgestaltung und die Forderung nach nachhaltigen Lösungen brauchen einen ganzheitlichen Blick, um die Schaffung von neuem Wohnraum, den Wandel urbaner Mobilität und den Wunsch nach Grün- und Freizonen innerhalb der Stadt sozial- und klimaverträglich zu gestalten.
„Baukultur heute – digital, nachhaltig, real“ beschäftigt sich dabei mit der Rolle, die der Umgang mit bestehenden Stadtstrukturen für die Gestaltung der Zukunft spielt. Wie kann der urbane Baubestand in der Planung der Stadt von morgen untergebracht werden? Welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung, welche konkreten Vorgehensweisen versprechen im Spannungsfeld zwischen Erhalt und Umwandlung den größten Erfolg? Wie werden die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner berücksichtigt?
Um ähnliche Fragen geht es auch im abschließenden „Condensed Spaces und die Städte von morgen“. Skizziert werden hierin die Probleme, die sich aus der immer größeren Verdichtung des Lebensraums Stadt ergeben. Im Zentrum des Beitrags stehen aber verschiedene Alternativen – von der vertikalen Verdichtung bis zu Mikro-Wohnformen –, um Nachverdichtung unter nachhaltigen Gesichtspunkten und mit dem Ziel, eine lebenswerte Umgebung zu schaffen, zu realisieren. Innovative und kreative Herangehensweisen und Technologien sind der Schlüssel, um die lebenswerte Stadt von morgen ganz real zu gestalten.
Die Stadt des 21. Jahrhunderts
…
Urbane Infrastruktur nachhaltig gestalten
Grüne Städte für die Zukunft
Städte waren und sind Schmelztiegel unterschiedlichster Interessen: Sie sind Orte des Handels, Industriestandorte, aber eben auch Lebensraum für viele verschiedene Menschen. Sie sind zugleich Ballungszentren, in denen sich aktuelle Entwicklungen verdichten. Aus dieser Verdichtung resultiert die Komplexität der Frage, wie urbane Infrastruktur zukunftsfähig und nachhaltig gestaltet werden kann.
Nachhaltige Stadtentwicklung ist deshalb in allen ihren Dimensionen eine Herausforderung – denn am Ende geht es immer um das Gesamtbild, das größer ist als seine Einzelteile.
- Drei Säulen, viel Handlungsbedarf
- Wie wollen wir wohnen? Stadt als nachhaltiger Wohnraum
- Wie wollen wir uns fortbewegen? Nachhaltige urbane Mobilität
- Wie wollen wir leben? Die nachhaltige Stadt als grüne Stadt
Drei Säulen, viel Handlungsbedarf
Seit einigen Jahren erleben die Städte – nicht nur in Deutschland – wieder einen stärkeren Bevölkerungszuwachs. Die Menschen ziehen dorthin, wo sie Arbeit finden, wo die Versorgungsmöglichkeiten günstig sind und wo eben auch andere Menschen sind. Das Phänomen der Schwarmstädte, die sich neben den üblichen Metropolregionen rasant entwickeln, bringt dabei noch eine weitere Komponente ins Spiel: Die Menschen ziehen dorthin, wo sie zusätzlich zu den genannten Bedürfnissen bezahlbaren Wohnraum vorfinden.
Stadtentwicklung und die Anforderungen der Nachhaltigkeit
Für die Stadtentwicklung entstehen daraus unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten große Herausforderungen:
- Mehr Menschen benötigen mehr Raum. Das steht aber im Widerspruch zu dem Anspruch, vorhandenen Raum nachhaltig zu nutzen – und diesen nicht durch neue Bebauung zu versiegeln.
- Mehr Menschen verbrauchen mehr Energie. Die Zielsetzung nachhaltiger Stadtentwicklung sieht aber einen geringeren Energieverbrauch vor.
- Mehr Menschen verursachen mehr Abfälle. Das ist nicht nur hinsichtlich des damit eng verbundenen Ressourcenverbrauchs problematisch, sondern auch in Bezug auf die Entsorgung von Materialien, die nicht wieder dem Materialkreislauf zugeführt werden können.
Quelle : https://abes-online.com/publikationen/dossier/die-lebenswerte-stadt-des-21-jahrhundert/
Wuppertaler bauen die größte grüne Fassade Europas
Lokalzeit Bergisches Land. 11.02.2020. 04:22 Min.. Verfügbar bis 11.02.2021. WDR. Von Stefan Quante.
Der pyramidenförmige, höchst energieeffiziente Bau von Stararchitekt Christoph Ingenhoven bekommt Hainbuchenhecken für Fassade und Dach – die größte grüne Fassade Europas entsteht. Aneinandergereiht wäre die Hecke acht Kilometer lang. Ein ungewöhnlicher Job auch für die beiden Wuppertaler Gärtner Sven Sagasser und Yvonne Bramsiepe, der sie bis in 27 Meter Höhe führt.
siehe auch Wikipedia zu Fassadenbegünung
Fassadenbegrünung Mehr Grün für unsere Städte
In den Innenstädten, insbesondere von großen Metropolen, sind Grünpflanzen meist Mangelware. Den Fassaden und Dachflächen kommt deshalb durch die Möglichkeit der Begrünung eine besondere Bedeutung zu, wenn es darum geht, den städtischen Wohn- und Arbeitsraum mit einfachen Mitteln ökologisch aufzuwerten. An dieser Stelle sollen die verschiedenen Formen der Fassadenbegrünung sowie deren Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt werden.
Vorteile von Fassadenbegrünungen
Die positiven Auswirkungen einer begrünten Fassade sind vielfältig und betreffen das städtische Mikroklima, die Bausubstanz und die Lebensqualität im Wohnraum.
- Verbesserung des Mikroklimas: Durch die Bildung von Pflanzenmasse wird Kohlenstoffdioxid aus der Umgebungsluft gebunden und Sauerstoff gebildet. Die Verdunstung von Wasser über die Blätter erhöht zudem die Luftfeuchtigkeit und senkt die Temperatur in der unmittelbaren Umgebung. Durch die Absorption von Staubteilchen auf der Blattoberfläche wird zudem die Luftbelastung verringert. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen beispielsweise der Universität Karlsruhe belegen, dass sich durch begrünte Fassaden die Stadtluft erheblich verbessern lässt.
- Sommerlicher Wärmeschutz und Wärmedämmung: Das dichte Blattwerk einer begrünten Wand schützt die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung und vermindert im Sommer auf diese Weise, insbesondere bei nicht gedämmten Gebäuden, das Aufheizen der Außenwände. Bei immergrünen Pflanzen wie z.B. Efeu kommt zudem eine wärmedämmende Wirkung in der kalten Jahreszeit hinzu.
- Biotop: Eine begrünte Wand stellt einen wertvollen Lebensraum für verschiedene Insekten und Vögel dar. Beispielsweise als Nistplatz für diverse Singvogelarten oder in Form von Blüten und Früchten als Nahrungsquelle. Allerdings können auch ungebetene Gäste, wie z.B. Wespen angezogen werden.
- Lärmschutz: das Blattwerk einer Fassadenbegrünung ist ein effektiver Lärmschutz, da Schallwellen geschluckt und in einem deutlich geringeren Maße reflektiert werden als durch die glatte Hauswand. Dadurch ist eine Lärmminderung von bis zu 10 Dezibel erreichbar.
- Schutz der Bausubstanz: Durch die Pflanzen werden Fassaden vor direkter UV-Einstrahlung, Schlagregen und Schmutzablagerungen geschützt. Bei alter Bausubstanz wird zudem das Erdreich durch den Wasserentzug der Pflanzen trocken gehalten. Allerdings kann es bei fehlender Pflege oder unsachgemäßer Ausführung auch zu Schäden an der Bausubstanz kommen. Einer intensiven Planung und der Auswahl geeigneter Pflanzen kommt hierbei besondere Bedeutung zu.
Quelle ökologisch bauen : https://www.oekologisch-bauen.info/baustoffe/dach/fassadenbegruenung/
“Nachhaltige Wege aus der Wirtschaftskriese” , Broschüren des Umweltbundesamtes , Mai 2020
Nachhaltige Wege aus der Wirtschaftskrise
Umwelt und Klima schützen, Beschäftigung sichern, sozialverträgliche Transformation einleiten
Umwelt- und Klimapolitik konsequent fortführen, Green Deal umsetzenEine Aufweichung oder Verschiebung umweltpoli-tischer Instrumente (European Green Deal, Kohle-ausstieg, CO2-Flottenzielwerte, CO2-Bepreisung im Inland etc.) ist keine sinnvolle Option zur Krisenbe-wältigung, denn Klimaerwärmung, Artensterben und Umweltverschmutzung richten mittel- und langfristig noch größere gesellschaftliche und wirtschaftliche Schäden an als die aktuelle Krise. Um abrupte und irreversible Veränderungen im Klima- und Erdsystem zu vermeiden und die Resilienz unserer Gesellschaf-ten zu erhöhen, sind beim Klima-, Umwelt-, Ressour-cen- und Naturschutz sofort und in den kommenden Jahren Ambitionssteigerungen und konsequentes Handeln nötig. Pfade zur Nachhaltigkeit sollten entsprechende, überprüfbare Ziele folgen ….
Mehr in der Broschüre des Umweltbundesamtes , hier zum Download :
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/poshi_0011_online.pdf
( Hinweis von Heidi )