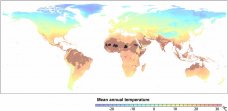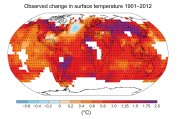Heise.de , von Axel Kannenberg , 03.05
Einleitung
Auf einem endlichen Planeten kann man nicht leben, als gebe es unendliches Wachstum, sagt Ökonom Niko Paech und plädiert für eine “Postwachstumsökonomie”.
Der Klimawandel stellt Wirtschaft und Gesellschaft vor enorme Herausforderungen. Nur eine Lebensweise, die ökologische und psychologische Wachstumsgrenzen respektiert und den Verzicht übt, sei da zukunftsfähig, sagt der Volkwirtschaftsprofessor Niko Paech. Er nennt sein Konzept “Postwachstumsökonomie”. Im Interview mit heise online legt er dar, was das für Politik, Wirtschaft und die Technikwelt bedeuten würde. Coronabedingt fand das Interview per E-Mail statt.
heise online: Deutschlands derzeitige Klimapolitik setzt mehr- oder minder auf einen New Green Deal – also im Wesentlichen die Fortführung unserer Lebens- und Produktionsweise auf Basis erneuerbarer Energien, besserer Energie-Effizienz und verstärktem Recycling. Reicht das ihrer Meinung nach aus?
Niko Paech: Dieses Konzept ist nicht nur wirkungslos, sondern selbst Teil des Problems, weil es gefährliche Lernresistenzen befördert. Ökologisch ruinöse Lebensstile werden gegen Wandel immunisiert, indem die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung auf die technischen und politischen Zuständigkeiten abgewälzt wird. Aber beides scheitert an der Hartnäckigkeit einer mehrheitlich praktizierten Daseinsform, deren zerstörerischer Charakter nicht durch Technik oder Politik repariert werden kann.
Nachdem bereits die Flugscham für Debatten gesorgt hatte, wurde inzwischen auch über “Streamingscham” gestritten. Sollte man sich schämen, wenn man Videos streamt?
Auf einem endlichen Planeten ist alles eine Frage des Maßes. Wer nie fliegt, kein Fleisch isst, eine kleine Wohnung hat, kein Auto fährt etc., kann durch maßvolles Streamen durchaus im Rahmen eines CO2-Fußabdrucks bleiben, der global übertragbar ist.
“Reparieren, was das Zeug hält!”
Was kann man als Durchschnittsnutzer aktuell tun, wenn man umweltschonender sein will – aber nicht auf Technik verzichten mag? Geht das überhaupt?
Reparieren, was das Zeug hält! Alte Geräte aufrüsten und wieder ertüchtigen. Damit wird zugleich ein Akzent pro Reparaturwirtschaft gesetzt, auf die es zukünftig ankommt. Außerdem können auch aus Konsumenten Reparateure werden, indem sie wieder selbst Hand anlegen, in der Schule, zuhause, im Reparatur-Cafe, in nachbarschaftlichen Netzwerken der Selbsthilfe, in gemeinschaftlich betriebenen Werkstätten, sodass wir eine lernende Gesellschaft in Sachen Bestandserhalt werden.
Weiterhin sind Gemeinschaftsnutzungen relevant. Wenn sechs Personen sich ein Auto, einen Drucker, eine Werkzeugausstattung, eine Waschmaschine, einen Rasenmäher etc. teilen, können diese Geräte einerseits modern sein, andererseits müssen weniger davon hergestellt werden.
Fast jede neue Generation von Geräten bringt nicht nur mehr Leistung, sondern auch höhere Effizienz. Sehen Sie da keine positiven Effekte?
Auch hier kommt es auf den Kontext an. Wer ein altes Gerät nach Ausschöpfung aller sinnvollen Nutzungsdauer verlängernden Maßnahmen schließlich doch irgendwann ersetzen muss und dann eine sparsamere Variante wählt, kann für Entlastung sorgen. Aber Effizienz und Sparsamkeit sind nicht dasselbe. Ein effizienterer Kühlschrank oder Flachbildschirm kann aufgrund vergrößerter Kapazität durchaus mehr verbrauchen als ein weniger effizientes, aber kleineres oder seltener in Anspruch genommenes Gerät.
Weiterhin drohen finanzielle Rebound-Effekte, nämlich dann, wenn die Kosteneinsparung mittels Effizienzsteigerungen wiederum die Nachfrage nach anderen Gütern erhöht. Überdies ist es fast immer so, dass die technische Effizienz mit verringerter ökologischer Konsistenz erkauft wird, wie beispielsweise bei LED-Lampen, die zwar effizienter als alte Leuchtmittel sind, deren Produktion und Entsorgung dafür aber umso problematischer ist. Schließlich können Effizienzverbesserungen einen Vorwand zur vorzeitigen Entsorgung von Geräten sein, auch wenn Weiterverwendung unter Berücksichtigung der in ihnen gebundenen Energie die sinnvollere Lösung wäre.
Mangel an rebellischen Verbrauchern
Wie hat sich denn die Nutzungsdauer von Geräten in Privathaushalten im Laufe der Jahre entwickelt?
Sie ist im Durchschnitt ausschließlich gesunken. Es mangelt noch immer an rebellischen Verbrauchern, die gegebenenfalls all das boykottieren, was zu schnell verschleißt und nicht reparabel ist. Erzähle mir niemand, dass es im Zeitalter von Web 2.0 zu schwierig sei, sich darüber hinreichend zu informieren.
Die Initiative Fairphone hat sich auf die Fahnen geschrieben, ein nachhaltiges Smartphone zu schaffen. Kann es ein nachhaltiges, umweltfreundliches Smartphone überhaupt geben?
Nein, kann es nicht. Es bräuchte längst einen Aufstand gegen die Smartphone-Epidemie. Insbesondere das Recht auf eine analoge Kindheit, wie kürzlich von der ÖDP gefordert, halte ich für elementar. Wer als Erwachsener dennoch nicht von der Nutzung einer solchen Identitätskrücke abzubringen ist, sollte dann trivialerweise besser ein Fairphone anstelle einer anderen Varianten kaufen.
Brauchen wir stärkere politische Vorgaben für nachhaltigere Technik?
Nichts wäre wünschenswerter als langlebigere und reparaturfreundlichere Produktdesigns. Aber erstens kosten die entsprechenden Objekte mehr, zweitens haben die oft weniger innovative Funktionen, drittens sinkt die Auswahl an Varianten. Und viertens entfallen die emotionalen Steigerungen, die mittels ständiger Neuanschaffungen, also durch Shopping-Erlebnisse zelebriert werden und die für viele längst den Sinn des Lebens verkörpern.
Dies alles wirft die Frage auf, wer dann eine Politik wählt, die genau dies herbeiführen will – außer jenen, die bereits ein entsprechendes Leben führen. Mit anderen Worten: Unter parlamentarisch-demokratischen Bedingungen kann eine gewählte Regierung sicher manches anstellen, aber eines niemals, nämlich gegen die Lebensgewohnheiten der Wählermehrheit agieren, denn das wäre politischer Selbstmord. Daraus folgt: Erst wenn die Gesellschaft eine medial sichtbare Bewegung gegen den frühen Verschleiß von Dingen hervorbringt, indem maximale Nutzungsdauerverlängerung zum kulturellen Code wird, kann die Politik ihre chronische Angst vor Wählerstimmenverlusten überwinden und entsprechende Rahmenbedingungen zu implementieren.
Ein Leben im CO2-Budget
Wie hoch wäre denn ein individuelles CO2-Verbrauchsbudget, das auf ein Jahr gesehen umweltfreundlich bleibt? Und wie würde so ein Leben im Budget aussehen?
Auf der Homepage des Umweltbundesamts ist von rund einer Tonne an CO2-Äquivalenten pro Kopf und Jahr die Rede. Der momentane Durchschnitt liegt in Deutschland bei ungefähr 12 Tonnen. Die hierzu nötige Reduktionsleistung kann nur im Rahmen einer Postwachstumsökonomie bewerkstelligt werden. Das bedeutet erstens eine Suffizienz-Bewegung, zweitens eine begleitende Selbstversorgerwirtschaft, begleitet von einer 20-Stunden-Arbeitswoche, drittens eine Stärkung der Regionalökonomie, viertens ein Umbau der nur noch halb so großen Industriekapazitäten. Und fünftens institutionelle sowie – falls sich jemals Mehrheiten dafür gewinnen lassen – politische Maßnahmen, die auf Selbstbegrenzung hinauslaufen.
Glauben Sie, dass viele Leute zu einem solchen Verzicht von sich aus bereit sind? Oder würden eher die Veränderungen durch den Klimawandel einen solchen Lebensstil erzwingen?
Mit jeder weiteren Krise – und Corona ist nur der Anfang einer Kette unterschiedlicher Eskalationsstufen, die alle auf dieselbe Ursache, nämlich ein globalisiertes Wachstumsmodell zurückzuführen sind – steigt die Anzahl der Menschen, die sich dem Steigerungs- und Fortschrittswahn verweigern werden. Übrigens, es geht dabei nicht um Verzicht, sondern um die Rückgabe einer Beute, die niemandem zustehen kann, der nur zwei Hände zum Arbeiten hat. Denn der ruinöse Wohlstand lässt sich nicht als Ergebnis menschlicher Anstrengung darstellen.
Vielmehr handelt es sich um den Einsatz eines globalen Maschinenparks, der menschliche Arbeit durch Ressourcenverzehr ersetzt hat. Außerdem leiden moderne Konsumgesellschaften zusehends unter psychischen Wachstumsgrenzen. Immer mehr Menschen stumpfen inmitten einer Lawine konsumtiver Möglichkeiten ab, weil ihnen die Aufmerksamkeit fehlt, dies alles stressfrei auszuschöpfen. Genügsamkeit kann also auch als Befreiung vom Überfluss aufgefasst werden.
“Die Digitalisierung ist nicht neutral”
Was würde die Postwachstums-Gesellschaft, wie Sie sie skizzieren, für die IT-Welt bedeuten?
Die Digitalisierung potenziert jede ökologische Plünderung bis ins Unermessliche. Einen effektiveren Sargnagel für die Lebensgrundlagen hätte sich niemand ausdenken können. Nun zu meinen, durch eine zusätzliche oder bessere Digitalisierung ließe sich die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft steigern, ist so klug wie Feuer mit Benzin löschen zu wollen.
Wir reden doch über eine neutrale Technik. Warum sollte Digitalisierung nicht für die optimale Planung einer schonenderen Ressourcennutzung verwendet werden können?
Nein, die Digitalisierung ist nicht neutral. Allein ihr direkter ökologischer Aufwand ist verheerend. Außerdem findet die optimale Planung, von der Sie sprechen, seit Jahrzehnten statt und bildet die Basis für die kosteneffiziente Spezialisierung und Globalisierung der Produktion. Darauf gründet eine zunehmend unkontrollierbare und auf Wachstum beruhende Maschinerie, die unsere Lebensgrundlagen aufzehrt und Krisengefahren heraufbeschwört. Ressourcenschonung ist eine Frage der suffizienten Kultur, nicht der Technik.
Sollte etwa das Internet abgeschaltet werden?
Das wird nur graduell und temporär möglich sein, wäre aber die Nagelprobe. Das Internet beispielsweise jeden zweiten Tag abzuschalten oder den Zugang zumindest für Kinder und Jugendliche hart zu limitieren, wäre unumgänglich. Schulen, die vom technischen Fortschrittswahn befreit sind, damit Kinder endlich wieder lernen könnten, worauf es in einer überlebensfähigen Gesellschaft ankommt, statt digital zu verblöden, sind ebenfalls sinnvoll.
Vollständiger Artikel bei heise.de
Auch die Diskussion ist sehr lesenswert.