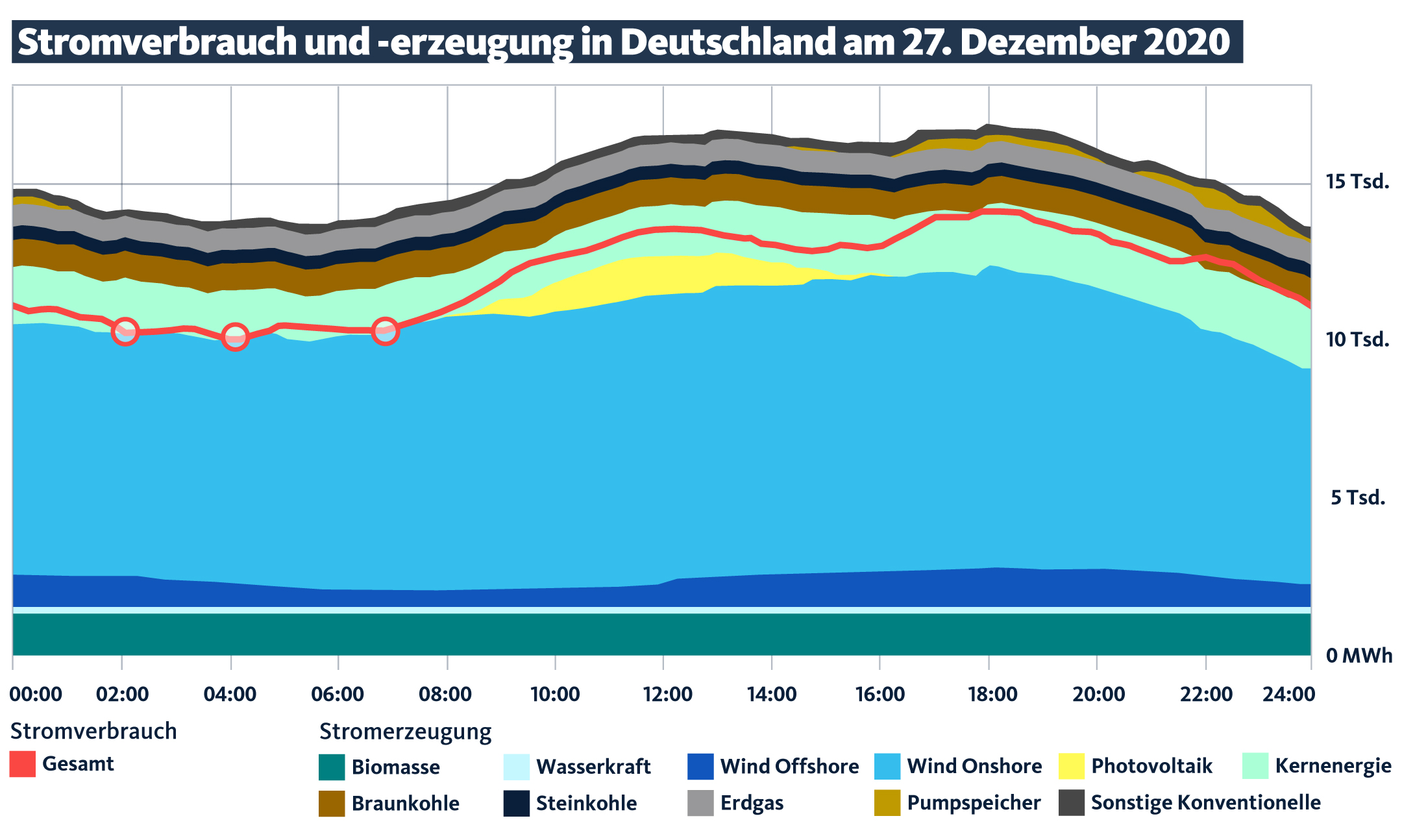(29.0ß3.21) Via Correctiv.org , spiegel.de ; Original : hier
Sie trinken gern Kaffee, essen gelegentlich Schokolade? Dann gehören Sie wahrscheinlich zu denen, die im Durchschnitt vier Bäume pro Jahr auf dem Gewissen haben. Der Spiegel berichtet über eine faszinierende Untersuchung einer japanischen Universität, die Daten über das Abholzen der Wälder und die Lieferketten von Produkten verglichen hat. Sie zeigt, wo Wälder für Agrarflächen gerodet werden, welche Produkte aus dem Anbau entstehen und in welchen Ländern diese Produkte konsumiert werden. In Deutschland sind es vor allem Kakao und Kaffee, aber auch Soja und natürlich auch Fleisch. Untersuchungen wie diese führen uns sehr konkret vor Augen, welche Folgen unser Konsum hat.
So viel Wald vernichtet unser Konsum (Spiegel)
Soja, Palmöl, Kakao So viel Wald vernichtet unser Konsum
Für den Anbau vieler Agrarprodukte wird wertvoller Wald abgeholzt. Nun haben Forscher im Detail ermittelt, welcher Konsum die Abholzung fördert – und welchen Anteil Deutschland daran hat. 29.03.2021, 18.05 Uhr
Es ist kein Geheimnis, dass manche Produkte aus dem Supermarktregal nicht die beste Umweltbilanz haben: Güter wie Kaffee, Kakao oder Palmöl werden auf Plantagen angebaut, Rinder brauchen Weideflächen. Dafür müssen in den Erzeugerländern oft wertvolle Wälder weichen. Klimakrise
Lesen Sie mehr über die neuesten Entwicklungen, Hintergründe und spannenden Lösungsansätze in unserem Themenspezial. Alle Artikel
Eine Studie hat nun untersucht, wie viel Waldfläche jeder Verbraucher rein rechnerisch durch seinen Konsum vernichtet.
…
Für den Zeitraum von 2001 bis 2015 kombinierten sie hochaufgelöste Daten zur Abholzung und ihren jeweiligen Ursachen mit einem globalen Handelsketten-Modell. Zwei Fragen standen bei der Auswertung im Vordergrund: Welche Länder sind über ihren Konsum für welche Abholzungs-Hotspots verantwortlich? Und welche Waldtypen werden durch die globalen Lieferketten vor allem beansprucht – tropische Regenwälder oder andere?
…
Die Auswertung ergab:
- »Waldschädigende« Produkte wie Sojabohnen, Palmöl oder Holz werden zumeist von tropischen Ländern wie Brasilien, Madagaskar, Indonesien oder der Elfenbeinküste in die G7-Länder und nach China exportiert.
- Japanische Konsumenten gefährden durch ihre Nachfrage nach Baumwolle und Sesam vor allem die Küstenwälder Tansanias.
- Der Konsum von Holz und Gummi in China wiederum führt in Indochina zur Abholzung.
- Kaffeetrinker in Deutschland, Italien und den USA treiben die Abholzung im vietnamesischen Hochland voran.
- Holzgewinnung in Nordvietnam wird vor allem durch die Nachfrage in China, Südkorea und Japan angetrieben.
Indem die Forscher die handelsbedingte Abholzung mit Karten zur Baumdichte in Regionen kombinierten, ermittelten sie, wie viele Baumflächen und einzelne Bäume Konsumenten in spezifischen Ländern auf dem Gewissen haben, bezogen auf das Jahr 2015:
- In Schweden sind es, vor allem wegen der Nutzung von Holz zur Elektrizitäts- und Wärmegewinnung, 22 Bäume – allerdings überwiegend aus heimischen Beständen.
- In China und Indien sind es dagegen weniger als einer.
- Die USA kommen auf fünf Bäume pro Kopf.
- In Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Japan sind es jeweils etwa die Hälfte davon.
Die letztgenannten Länder hinterlassen in Bezug auf Abholzung 91 bis 99 Prozent ihres ökologischen Fußabdrucks in anderen Ländern, im Jahr 2015 entfielen davon 46 bis 57 Prozent auf tropische Wälder. Insgesamt sei gerade dort der Druck durch Abholzung sehr hoch, so die Forscher.